31.10.2025 Postkoloniale Perspektiven auf Wissensdiplomatie und Frieden: Marburger Forschung im globalen Austausch
Internationale Konferenzen in Tunis des von der Philipps-Universität koordinierten MECAM-Zentrums
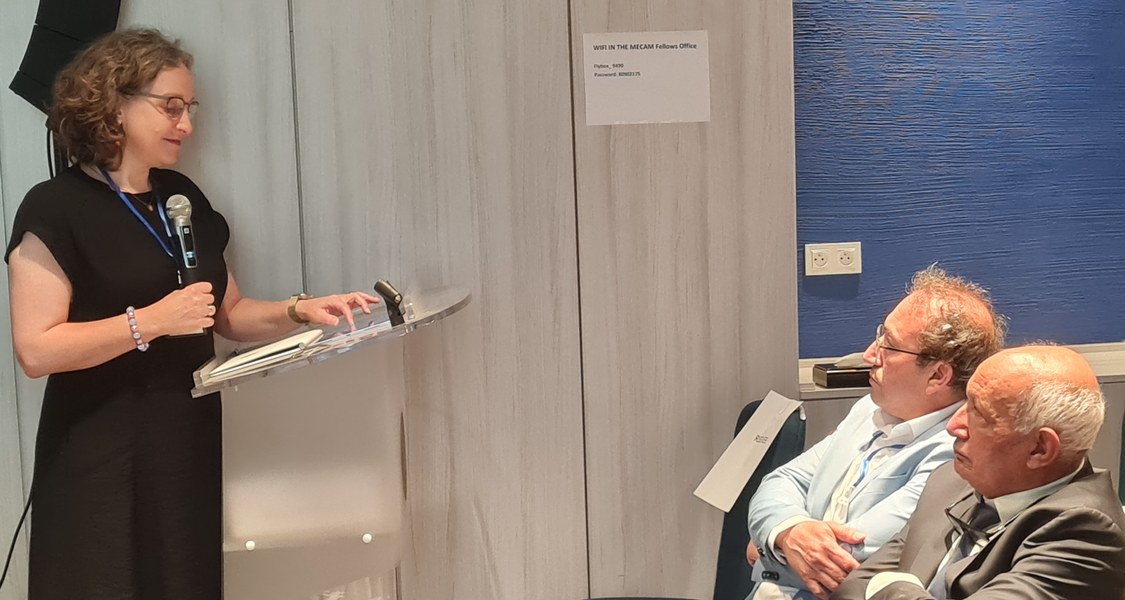
Das von der Philipps-Universität Marburg und der Université de Tunis koordinierte Merian Centre for Advanced Studies in the Maghreb (MECAM) lud vom 10.-13. Oktober 2025 zu einer Doppelveranstaltung an seinem Standort in Tunis ein: Die internationale Konferenz „Re-thinking Peace and Conflict Studies in a Postcolonial World“ (10.-11. Oktober) brachte Forschende aus dem Netzwerk „Postcolonial Hierarchies in Peace and Conflict“ sowie regionale Partner zusammen, um die Disziplinen Friedens- und Konfliktforschung aus postkolonialer Perspektive neu zu betrachten.
Und im Anschluss (12.-13. Oktober) fand das Merian Family Meeting unter dem Titel „Knowledge Diplomacy and South-South-North-Cooperation: Revitalizing Bandung for the 21st Century in the Merian Centres Network” statt – ein Treffen der weltweit fünf Merian-Zentren zur Stärkung transnationaler, multilingualer und dekolonisierender Wissenskooperation. Es nahmen insgesamt über 60 Gäste aus verschiedenen Ländern und Kontinenten teil.
Die internationale Konferenz „Re-thinking Peace and Conflict Studies in a Postcolonial World“ bildete den Abschluss des Forschungsnetzwerks „Postcolonial Hierarchies in Peace and Conflict“, dem das Zentrum für Konfliktforschung der Philipps-Universität Marburg sowie drei weitere deutsche Institute und Universitäten angehören. Außerdem kooperiert das Netzwerk mit interdisziplinären Forschungszentren und Universitäten weltweit. In Tunis kamen Expertinnen und Experten zusammen, um die Friedens- und Konfliktforschung aus einer postkolonialen Perspektive neu zu denken — mit einem besonderen Fokus auf die Dekolonialisierung von Wissensbeständen, die Kritik eurozentrischer Sicherheitskonzepte sowie auf Ansätze transformativer Gerechtigkeit. Die Konferenz beinhaltete akademische Panels, Roundtables und Keynotes und diente zugleich als Plattform zur Vorstellung zentraler Netzwerkpublikationen, darunter ein neues Handbuch sowie eine digitale Encyclopaedia zur Umdeutung bestehender Forschungsfelder.
Im Rahmen des Merian Family Meetings kamen alle fünf Merian-Zentren — MECAM (Tunis), ICAS:MP (Delhi), CALAS (Guadalajara), MECILA (São Paulo) und MIASA (Accra) — vor Ort zusammen, um Strategien für eine gerechtere, plurale Forschungspraxis zu entwickeln. Ausgehend von den anti-kolonialen Prinzipien der Bandung-Konferenz (1955) arbeiteten die Zentren an einer gemeinsamen Agenda für Wissensdiplomatie: Stärkung lokaler Forschungsinfrastrukturen, Anerkennung nicht-hegemonialer Wissenssysteme, Förderung mehrsprachiger Wissenschaftskommunikation sowie die Implementierung nachhaltiger South–South- und South–South–North-Kooperationsformate. Neben fachlichen Austauschrunden wurden gemeinsame Strategien für die Vernetzung, Publikation und Sichtbarmachung marginalisierter Forschungsperspektiven erarbeitet. Programmpunkte wie die Rencontre Ibn Khaldun („Decolonizing Knowledge”) sowie bilaterale und multilaterale Sessions zwischen Netzwerkpartnern und regionalen Akteur:innen sollten Wege eröffnen, epistemische Asymmetrien zu adressieren und die Rolle regionaler Zentren zu stärken.
Die Teilnehnmer:innen wurden von der Deutschen Botschafterin in Tunis, Frau Elisabeth Wolbers, empfangen. Vor Ort dabei waren neben zahlreichen Vertreter*innen der beiden Universitäten Marburg und Tunis auch Malek Kochlef vom Tunesischen Ministerium für Hochschulbildung und Wissenschaftliche Forschung. Prof. Dr. Evelyn Korn, Vizepräsidentin für Universitätskultur und Qualitätsentwicklung an der Philipps-Universität Marburg, nahm ebenfalls am Merian Family Meeting teil. Sie betonte die Bedeutung internationaler Partnerschaften im Merian-Netzwerk: „MECAM steht beispielhaft für eine wichtige Form der Wissenskooperation und zeigt, wie Wissensdiplomatie in der Praxis gelingen kann – durch Austausch auf Augenhöhe und gemeinsame Verantwortung für gerechtere Forschungszusammenarbeit. Für die Universität Marburg ist es ein großer Gewinn, dieses Zentrum gemeinsam mit der Université de Tunis zu gestalten.“
In seiner Rolle als Gastgeber der Doppelveranstaltung brachte MECAM als interdisziplinäres Forschungszentrum in Tunis ein: MECAM fördert die Internationalisierung der Geistes- und Sozialwissenschaften im Mittelmeerraum und versteht sein Leitthema „Imagining Futures – Dealing with Disparity“ als Aufforderung, historische und gegenwärtige Ungleichheiten sichtbar zu machen und gemeinsam nach gerechten Zukunftsperspektiven zu suchen. Der Fokus liegt dabei auf der (Neu-)Verhandlung komplexer sozialer und politischer Bedingungen und Erwartungen, Normen und Vermächtnisse im Zuge des „Arabischen Frühlings“ im Maghreb, im Nahen Osten, in Europa und darüber hinaus. Der notwendige Hintergrund für diese Prozesse sind die Ungleichheiten und Ungleichheiten, die den Maghreb und seine Nachbarregionen trennen - sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart.
MECAM ist eine gemeinsame Initiative von sieben deutschen und tunesischen Universitäten und Forschungseinrichtungen und wird vom deutschen Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) finanziert.
Weitere Informationen: https://www.mecam.tn
Kontakt
Benjamin Heidrich
Tel.: 06421 28 24959
Mail: benjamin.heidrich@uni-marburg.de
Projektkoordinator
Centrum für Nah- und Mittelost-Studien
Philipps-Universität Marburg