Hauptinhalt
Forschungsprojekte
Der Forschungsschwerpunkt unseres Instituts liegt auf der translationalen Tumorforschung mit Fokus auf Brust-, Ovarial-, gastrointestinalen und neuroendokrinen Tumoren. Dabei stehen die Identifizierung und Validierung prädiktiver und prognostischer Biomarker im Mittelpunkt – mithilfe moderner Multiomics-Analysen im räumlichen Gewebekontext. Wir sind eng vernetzt in nationalen und internationalen Forschungsverbünden, darunter EU- und BMBF-geförderte Projekte. Eine enge Kooperation besteht mit klinischen Studiengruppen wie der German Breast Group (GBG) und der AGO. Unser Ziel ist es, durch innovative Forschung die personalisierte Onkologie voranzutreiben.
Kooperation mit der German Breast Group

Google GBG Unser Institut arbeitet eng mit der German Breast Group zusammen und ist fester Bestandteil zahlreicher internationaler klinischer Studien und translationaler Forschungsprojekte im Bereich Brustkrebs. Als Zentral-Pathologie sind wir verantwortlich für die pathologische Eingangsdiagnostik, sowie Verwaltung und Betreuung der umfangreichen FFPE-Biobank mit über 55.000 Gewebeproben von mehr als 35.000 Patientinnen.
Für moderne digitale Bildanalysen stehen uns aktuell rund 200.000 digitalisierte Gewebeschnitte zur Verfügung, die eine präzise und effiziente Auswertung ermöglichen. Diese Ressourcen bilden die Grundlage für innovative Forschungsansätze und tragen wesentlich zur Entwicklung personalisierter Therapiestrategien bei. Mehr Informationen finden Sie hier.
Kooperation mit der AGO

Unser Institut pflegt eine enge Zusammenarbeit mit den Arbeitsgemeinschaften Ovarialkarzinom (AGO-Ovar) und Brustkrebs (AGO-Breast). Gemeinsam unterstützen wir nationale und internationale klinische Studien sowie translationale Forschungsprojekte, um Diagnostik und Therapie dieser Tumorarten kontinuierlich zu verbessern. Durch die Verbindung von pathologischer Expertise und klinischer Forschung fördern wir die Identifizierung innovativer Biomarker und die Entwicklung personalisierter Behandlungsstrategien. Diese Partnerschaft stärkt unseren Beitrag zur Patientenversorgung und den wissenschaftlichen Austausch auf hohem Niveau. Mehr Informationen finden Sie hier.
Kooperation mit dem Brustzentrum der Charité Berlin


Gemeinsam mit dem Brustzentrum der Charité Universitätsmedizin Berlin führen wir Registerstudien zum Invasiv-lobulären Mammakarzinom (ILC) und Brustkrebs bei Jungen-Patientinnen.
Hierfür sammeln wir zu translationalen Forschungszwecken Biomaterial und klinische Verlaufsdaten im ILC-Register und Berlin-Young-Patient Register (BYP). Mehr Informationen finden Sie hier.
MAGNOLIA

Triple-negativer Brustkrebs (TNBC) macht 15–20 % aller Brustkrebsfälle aus. Obwohl PD-L1 bei TNBC häufig exprimiert wird und eine Anti-PD-L1-Immun-Checkpoint-Blockade (ICB) zusammen mit Chemotherapie die Behandlungsergebnisse verbessern kann, bleibt der klinische Nutzen begrenzt und betrifft nur eine Untergruppe von TNBC-Patientinnen. Um die Therapieoptionen zu verbessern, ist ein besseres Verständnis der PD-L1-Verteilung und des Ansprechens auf die ICB notwendig.
In diesem Projekt analysieren wir die Tumormikroumgebung von TNBC-Proben vor und nach der ICB-Behandlung mithilfe von Multi-Omics-Analysen primärer und metastasierter Läsionen aus zwei randomisierten klinischen Phase-II-Studien (GeparNuevo & SYNERGY). Mehr Informationen finden Sie hier.
SATURN3

Das Projekt „SATURN3“ untersucht die räumliche und zeitliche Entwicklung der Tumorheterogenität bei Krebserkrankungen. Tumorheterogenität beschreibt die Vielfalt von Zellen innerhalb eines Tumors, die eine wichtige Rolle bei Resistenz, Metastasenbildung und Rückfall spielen kann. Der Fokus liegt auf drei Krebsarten mit besonderer Betroffenheit: Brust-, Darm- und Bauchspeicheldrüsenkrebs. Mehr Informationen finden Sie hier.
PM4Onco

Das Projekt PM4Onco verfolgt das Ziel, IT-technische Grundlagen für die Etablierung personalisierter Medizin in der Krebsbehandlung zu schaffen. Durch die Zusammenführung verschiedener Datenquellen – von genetischer Diagnostik über Tumordokumentation bis hin zum Krankheitsverlauf – soll der gesamte Behandlungsprozess für die Forschung und zukünftige Patienten besser nutzbar gemacht werden. Mehr Informationen finden Sie hier.
Big Picture

Bigpicture ist die erste europäische, ethisch und regulatorisch konforme, gemeinschaftsbasierte Plattform, die eine große Menge qualitätskontrollierter, kommentierter Pathologiebilder mit KI-Algorithmen zusammenführt. Die Plattform wird nachhaltig und integrativ entwickelt und bringt Pathologen, Forscher, KI-Entwickler, Patientinnen und Industriepartner auf Basis gegenseitiger Nutzung und Wertschöpfung zusammen. Mehr Informationen finden Sie hier.
RAD51predict

Tumore mit DNA-Reparaturdefekten, z. B. bei BRCA1-/BRCA2-Mutationsträgerinnen, sprechen besonders gut auf bestimmte Chemotherapien und PARP-Inhibitoren an. Ob Tumorzellen DNA-Reparaturdefekte aufweisen, kann mit einem Test basierend auf dem DNA-Reparaturprotein RAD51 geprüft werden. Das Projekt RAD51 predict will den prädiktiven Wert dieses Tests bei Brustkrebs evaluieren, um die Diagnose und Therapieauswahl zu verbessern. Mehr Informationen finden Sie hier.
Integrate TN

Das von der Deutschen Krebshilfe geförderte Projekt INTEGRATE-TN untersucht therapieinduzierte zeitliche Veränderungen in Tumorproben aus klinischen Studien. Organoidkulturen einzelner Tumorzellen werden angelegt und analysiert, um die Reaktion auf Umweltveränderungen engmaschig zu beobachten. Ziel ist die Entdeckung neuer Biomarker, die Therapieansprechen und Resistenz vorhersagen und künftig Therapieentscheidungen unterstützen sollen. Mehr Informationen finden Sie hier.
Oncobiome
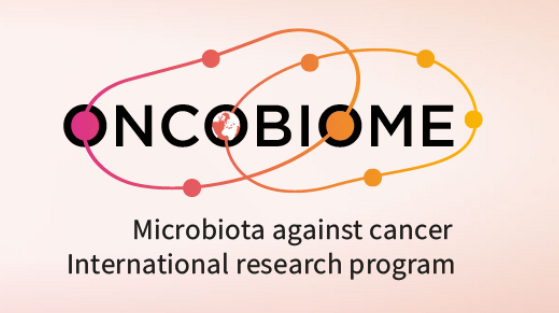
Die Onkobiom-Forschung untersucht den Zusammenhang zwischen Krebs und der Darmmikrobiota. Es ist bekannt, dass das intestinale Mikrobiom viele physiologische Funktionen beeinflusst und eine Rolle bei Krebsentstehung, -progression und Therapieansprechen spielt, auch bei Tumoren außerhalb des Darms. Mehr Informationen finden Sie hier.
TargHet

Das Forschungsprojekt TargHet beschäftigt sich mit der intratumoralen Heterogenität bei Darmkrebs – einem Hauptgrund für Therapieresistenz und hohe Sterblichkeit. Diese Vielfalt auf genetischer, epigenetischer und phänotypischer Ebene ermöglicht es Tumorzellen, der Behandlung zu entkommen. Ziel ist die molekulare Charakterisierung dieser Heterogenität, die Entschlüsselung zugrundeliegender Mechanismen und die Entwicklung gezielter Therapien. Hierfür kommen modernste Technologien wie Einzelzellsequenzierung, Multiomics und CRISPR-Screening zum Einsatz. KI-gestützte Datenintegration soll Schlüsselmechanismen identifizieren, um präzisionsmedizinische Ansätze voranzutreiben. Mehr Informationen finden Sie hier.
Gilead ILC
Das Gilead ILC (Immune Landscape Characterization) Forschungsprojekt widmet sich der Untersuchung der immunologischen Mikroumgebung bei verschiedenen Krebsarten mit dem Ziel, neue immuntherapeutische Ansätze zu entwickeln.
Mittels modernster Technologien wie Multiplex-Immunfluoreszenz, Einzelzelltranskriptomik und KI-gestützter Bildanalyse werden die komplexen Wechselwirkungen zwischen Tumorzellen und dem Immunsystem im räumlichen und funktionalen Zusammenhang analysiert. Dabei liegt der Fokus auf der Identifikation spezifischer Immunsignaturen, die mit dem Ansprechen auf Therapien oder der Entstehung von Resistenzen in Verbindung stehen.
Besonderes Augenmerk gilt der Charakterisierung von Immunzellpopulationen, deren Aktivierungszustand sowie ihrer Rolle bei der Tumorprogression. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen zur Entwicklung neuer Biomarker beitragen, die eine präzisere Auswahl von Patientinnen und Patienten ermöglichen und die Optimierung bestehender Therapien unterstützen.