Hauptinhalt
AG Janis Müller
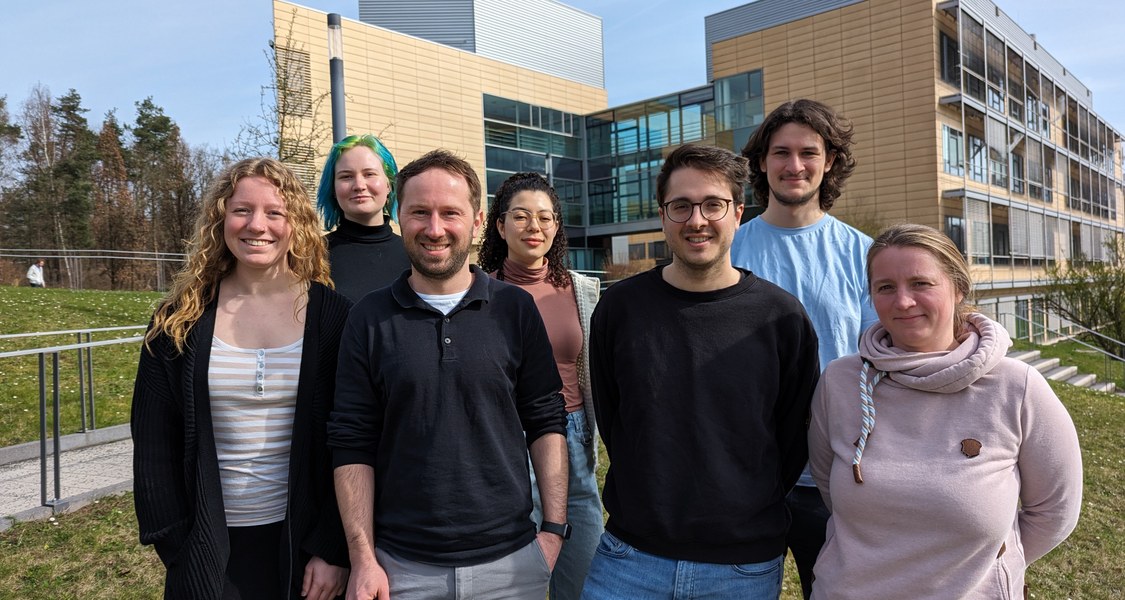
Die AG Müller ist eine Nachwuchsgruppe, die sich für das Zusammenspiel von Viren und körpereigenen extrazellulären Vesikeln interessiert. Der Forschungsschwerpunkt liegt hierbei auf Flaviviren, deren Zelleintritt durch Vesikel aus verschiedenen Körperflüssigkeiten gehemmt wird. Die AG Müller möchte diesen antiviralen Mechanismus verstehen und dessen Implikation für Virusübertragungswege und mögliche klinische Anwendungsgebiete genauer untersuchen.