Hauptinhalt
Dr. Paulina S. Gennermann
| Wissenschaftliche Mitarbeiterin paulina.gennermann@uni-marburg.de |
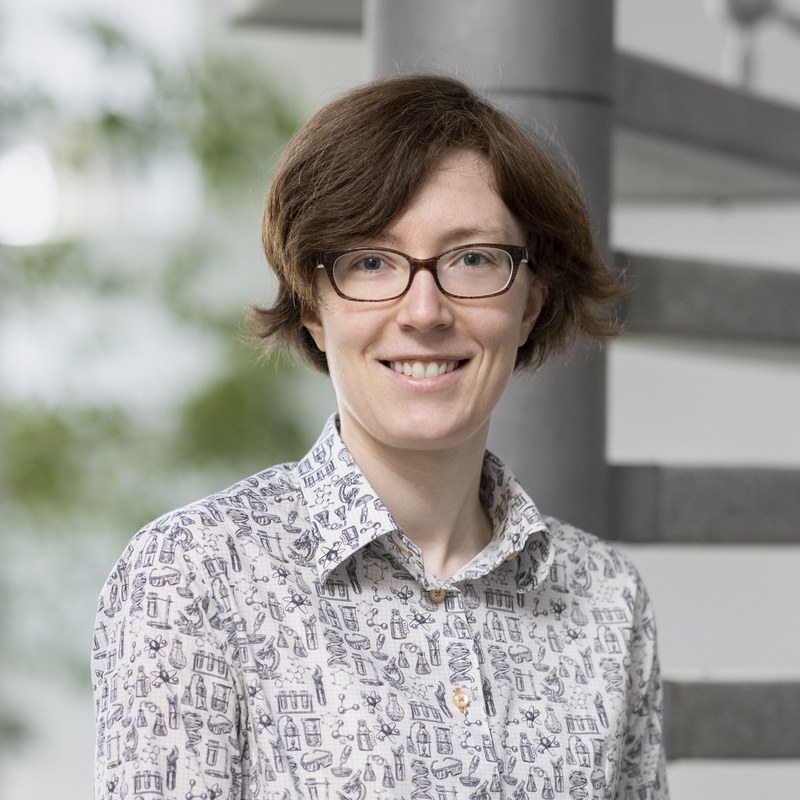
|
Forschungsinteressen
- Geschichte der Aroma- und Duftstoffe
- Geschichte von Geruch und Geschmack
- Entwicklung der Psychopharmakologie
- Zusammenhänge von Wissenschaft-Wirtschaft-Gesellschaft
- Natürlichkeit und Normalität
- Wissenschaft in globalen und kolonialen PerspektivenCurriculum Vitae
2019-2023 Promotion, Universität Bielefeld, Bielefeld Graduate School in History and Sociology
2016-2019 Master of Arts, Universität Bielefeld, “History, Economics, and Philosophy of Science”
2012-2016 Bachelor of Arts/Licence, Universität Bielefeld/Université Paris Diderot, Geschichte und BiologieHabilitationsprojekt
Psychotrope Stoffe zwischen allen Stühlen: Eine brasilianische Globalgeschichte der Psychopharmakologie im 20. Jahrhundert (Arbeitstitel)
- versão portuguesa embaixo -
Seit Beginn der modernen Psychopharmakologie in der Mitte des 20. Jahrhunderts ist ihre Historiographie eurozentristisch geprägt. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen zumeist europäische und nordamerikanische Quellen sowie Personen, um die Entwicklung sowohl der psychopharmazeutischen Industrie und ihrer Produkte als auch der wissenschaftlichen Disziplin zu untersuchen. Mein Projekt zielt darauf ab, die markant eurozentristische Sichtweise aufzubrechen und konzentriert sich auf die Geschichte der Psychopharmakologie und der Psychopharmazeutika in Brasilien in den 1960er- bis 1980er Jahren. Dem Ansatz der Global- und Verflechtungsgeschichte folgend werden internationale Entwicklungen einbezogen und im Hinblick auf ihre nationalen Konsequenzen untersucht.
Mit diesem Forschungsprojekt verfolge ich drei primäre Ziele: Erstens soll gezeigt werden, dass es sich bei der Geschichte der Psychopharmakologie und der Psychopharmazeutika um eine globale Geschichte handelt. Deswegen ist es erforderlich, Bewegungen und Entwicklungen außerhalb des Globalen Nordens, insbesondere außerhalb Nordamerikas und Europas, in die Geschichtsschreibung einzubeziehen. Zweitens werden Wahrnehmung und Interpretation von Psychopharmazeutika in der Gesellschaft analysiert. Diese Stoffe zeichnen sich durch eine besondere Ambivalenz aus, oszillierend zwischen positiven, nützlichen Medikamenten und stigmatisierten, schädlichen Rausch- und Betäubungsmitteln. In diesem Projekt werden die Entwicklung und Manifestationen dieses vielschichtigen Verständnisses herausgearbeitet. Da Brasilien im Untersuchungszeitraum durch ein autoritäres Militärregime geprägt war, ist es bei der Analyse der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Psychopharmazeutika notwendig, die politische Prägung und Struktur des Landes mitzudenken und mögliche Konsequenzen für den Umgang mit den fraglichen Stoffen herauszuarbeiten. Aus diesem Grund ist es drittens ein Ziel dieser Arbeit, den Umgang mit Psychopharmazeutika während der brasilianischen Militärdiktatur zu entschlüsseln. Ein detailliertes und tiefgreifendes Bild über Psychopharmazeutika in den 1960er- bis 1980er Jahre zu erarbeiten, schließt zwangsläufig eine Untersuchung politischer Einflüsse ein.
Um diese drei Ziele zu erreichen, werden vier Leitfragen gestellt: Wie wurden Psychopharmazeutika charakterisiert und wie wurden sie in Gesellschaft und Politik dargestellt? Welchen Einfluss hatte die Interpretation des Charakters von Psychopharmazeutika auf ihr gesellschaftliches Image und auf den Umgang mit ihnen? Welchen Einfluss hatte die Militärdiktatur auf die Regulierung und die Wahrnehmung von Psychopharmazeutika? Wie war das Netzwerk, in dem sich Psychopharmazeutika bewegten, strukturiert, wer wirkte mit und wer beeinflusste wen?
Gemeinsam stellen die drei Ziele des Projekts und die vier Leitfragen nicht nur eine innovative Studie über die Geschichte psychotroper Stoffe in Brasilien dar. Sie offerieren auch einen neuen Zugang zur Geschichte der Psychopharmakologie und der Psychopharmazeutika im Sinne einer Global- und Verflechtungsgeschichte, die über die eurozentristische Sichtweise hinausgeht.
Psicotrópicos na encruzilhada: Uma história global brasileira da psicofarmacologia no século XX (working title)
Desde o início, a historiografia da psicofarmacologia e dos psicofarmacêuticos foi caracterizada por uma perspectiva eurocentrista marcante. Geralmente, os desenvolvimentos não só da indústria e dos seus produtos, mas também da psicofarmacologia foram analisandos concentrando-se em eventos, documentos e personagens de países europeus e norte-americanos. Neste projeto, o foco será no Brasil entre os anos 1960 e 1980, abrangendo conexões internacionais.
Este projeto segue três objetivos principais: Primeiro, será mostrado que a história da psicofarmacologia e dos psicofarmacêuticos é uma história global. Assim, é imperativo que os desenvolvimentos de países de fora da Europa e dos EUA sejam incluídos nos estudos dessa história. Este projeto, centrando-se na perspectiva brasileira e nas conexões internacionais do Brasil, abre a historiografia da psicofarmacologia e dos psicofarmacêuticos para uma abordagem menos eurocentrista. Segundo, a percepção e interpretação dos psicofarmacêuticos na sociedade serão esclarecidas. Visto que essas substâncias foram percebidas de uma maneira ambivalente, oscilando entre remédios benéficos, remédios perigosos e potenciais entorpecentes, é necessário analisar profundamente o desenvolvimento dessa percepção e as suas razões. Focando nos anos 1960 até 1980, que, no Brasil, foram caracterizados para um regime militar, estudar a percepção e interpretação dos psicofarmacêuticos precisa incluir pensar nas influências da estrutura política e social e das suas consequências para o tratamento com essas substâncias. Então, o terceiro objetivo do projeto é ilustrar a história dos psicofarmacêuticos durante a ditadura militar brasileira. Para elucidar os caraterísticos de psicofarmacêuticos é importante analisar a sua imagem política e os seus efeitos.
A fim de que alcançar os três objetivos, a análise é estruturada por quatros perguntas principais: Os psicofarmacêuticos foram caracterizados como remédios, tóxicos ou de uma outra forma e como foram apresentados e percebidos na sociedade brasileira e na política? Quais consequências tinha a percepção no caráter social e no trato dessas substâncias? Qual influência tinha a estrutura da ditadura militar na regularização e na percepção dos psicofarmacêuticos? Como pode a rede dos psicofarmacêuticos ser caracterizada, quem participou nela e quem influenciou quem nessas estruturas?
Respondendo estas perguntas principais e combinando estes três objetivos, este projeto contribui não só uma pesquisa inovadora sobre a história dos psicofarmacêuticos no Brasil, mas ainda sugere uma nova perspectiva para estudos sobre a história da psicofarmacologia.Publikationen
„A Game of Terms: Constructing Naturalness in German Flavour Regulation, 1959–2008", Ambix 72, Nr. 1 (2025): 10-19, DOI: 10.1080/00026980.2025.2456359.
https://www.jargonium.com/post/bridging-the-gap-between-chemistry-and-society-natural-and-artificial-from-a-history-of-flavour-s-p
„Becoming Natural: The Naturalization of Synthetic Flavors in the Twentieth Century and the Introduction of Konsumstoff“, Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 46, Nr. 4 (2023): 303-319, DOI: 10.1002/bewi.202300016.
Eine Geschichte mit Geschmack. Die Natur synthetischer Aromastoffe im 20. Jahrhundert am Beispiel Vanillin (Berlin, Boston: De Gruyter Oldenbourg, 2023), DOI: 10.1515/9783111190297.
Vorträge und Konferenzen
Panelorganisation (14ICHC València): „Toxic Tales?! - (Il)legitimate uses of chemical substances in twentieth century Brazil" mit eigenem Panelbeitrag
Konferenzorganisation „Chemical Connections: Studying Interdisciplinarity through the history of a discipline”, 04.-07.10.2023, ZiF Bielefeld, und eigener Beitrag: „Tasting flavors and smelling fragrances” gemeinsam mit Carsten Reinhardt
Input in „Conversations on the History of Chemistry 3. Food, toxicity and the life sciences”, 15.06.2023
Panelbeitrag (13ICHC Vilnius): „The naturalization of chemical substances: How synthetic flavors became natural during the 20th century“, Panel: “Constructing naturalness”, 24.05.2023Aktuelles aus Medien und Öffentlichkeit
Stipendien und Auszeichnungen
- Bettina-Haupt-Förderpreis für Geschichte der Chemie 2024
- Society for the History of Alchemy and Chemistry (SHAC), Research Award 2023, 1000£
- Commission on the History of Chemistry and Molecular Sciences, Reisestipendium für die 13ICHC, Vilnius (23.-27.05.2023)
- Studienstiftung des Deutschen Volkes, Promotionsstipendium (09.2020-12.2022)
- Bielefelder Nachwuchsfonds, Sach- und Reisemittel (2021-2022)Mitgliedschaften
- Fellow des Jungen ZiF, Zentrum für interdisziplinäre Forschung, Universität Bielefeld
- Gesellschaft für die Geschichte der Naturwissenschaften, der Medizin und der Technik (GWMT)
- Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh), Fachgruppe Geschichte der Chemie
- Society for the History of Alchemy and Chemistry (SHAC)
- Institute for Interdisciplinary Studies of Science (I²SOS Bielefeld)Akademische Selbstverwaltung
06.2024 Wahl zu einer der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten des FB 06
09.2021-09.2023 Mitglied im Organisationsteam des Driburger Kreises
11.-13.11.2022 Mitglied des Auswahlkomitees für neue Studierende der Studienstiftung des Deutschen Volkes