Dr. Till Huber
Wiss. Mitarbeiter, Redaktionsleitung
Kontaktdaten
+49 6421 28-24937 till.huber@ 1 Deutschhausstraße 335032 Marburg
F|04 Institutsgebäude (Raum: B125 bzw. +1/2250)
Organisationseinheit
Philipps-Universität Marburg Germanistik und Kunstwissenschaften (Fb09) Institut für Neuere deutsche Literatur Moderne - Gegenwart - Literaturvermittlung in den Medien (Literaturvermittlung)Aktuelles
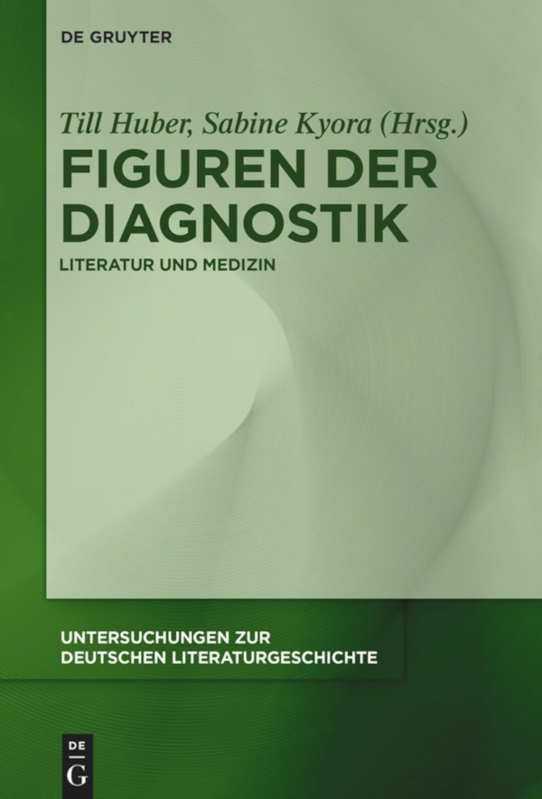
|
Kürzlich ist bei De Gruyter der von Sabine Kyora und Till Huber herausgegebene Band Figuren der Diagnostik in der Reihe Untersuchungen zur deutschen Literaturgeschichte erschienen. Der Aufsatzband geht der Frage nach der Verknüpfung von medizinischem Wissen und ästhetischem Verfahren nach. Den Ausgangspunkt bildet die Hypothese, dass literarische Texte ab 1800 ‚diagnostische Schreibweisen‘ entwickeln und so Diagnostizieren als ein für die Moderne typisches Narrativ etablieren. Mit Beiträgen von Thomas Boyken, Urte Helduser, Christine Kanz, Martina King, Anja Schonlau, Elisabeth Strowick, Sophie Witt u.a. Verlagslink |

|
Ende 2023 erschien Ästhetik des Depressiven, hg. von Till Huber und Immanuel Nover, in der Reihe spectrum Literaturwissenschaft bei De Gruyter. Untersucht werden Motive und literarische Verfahren des Depressiven, depressive Figuren und einschlägige Inszenierungen von Autor/innen wie Albert Ehrenstein, Hans Fallada, Wolfgang Herrndorf, Hermann Hesse, Michael Köhlmeier, Benjamin Maack, Thomas Melle, Terézia Mora, Leif Randt, Franziska zu Reventlow, Kathrin Röggla, David Foster Wallace und Robert Walser. Im Rahmen des Programms „Open-Access-Transformation für exzellente Publikationen aus der Deutschen Literaturwissenschaft“ wurde der Band mit der Unterstützung von 35 wissenschaftlichen Bibliotheken als eine von neun Neuerscheinungen Zur Open-Accesss-Publikation ausgewählt. Der Volltext ist hier abrufbar. |
Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Sprechstunde in der Vorlesungszeit
mittwochs, 11–12 Uhr, mit Anmeldung per Email
Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Sprechstunde in der vorlesungsfreien Zeit
nach Vereinbarung (Anmeldung per Email)
Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Projekte der Lehrredaktion im MA-Studiengang „Literaturvermittlung in den Medien“
Hier finden Sie Informationen zu Projekten der Lehrredaktion im MA-Studiengang „Literaturvermittlung in den Medien“.
Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Aktuelle Forschungsprojekte
Literarische Diskurse des Depressiven 1880–1933
Die Studie untersucht Depressionsdarstellungen in der Literatur des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts und fragt, inwiefern sich der Depressionsdiskurs in der Kultur des frühen 20. Jahrhunderts konstitutiv auf die Schreibverfahren der Moderne auswirkt. Somit werden insbesondere die ästhetischen Repräsentationen der Krankheit in Erzähltexten des Fin de siècle, der 1910er Jahre und der Neuen Sachlichkeit fokussiert. In intertextuellen Lektüren werden Wechselwirkungen von literarischen und psychoanalytischen/psychiatrischen Texten untersucht. Die Kontextualisierung mit außerliterarischen Diskursen des Depressiven verfolgt eine Revision der literarischen Moderne, die Depression als historisch wandelbares Phänomen begreift und als bisher ‚verborgenen‘ Diskurs der Moderne vermutet. In der Analyse werden die folgenden Hypothesen verfolgt: a.) Depression steht als unproduktiver, ‚stagnierender‘ und dysfunktionaler Zustand in Opposition zum Fortschrittsgedanken der Moderne. b.) Depression stellt sich (literarisch) als Rückzug von der sozialen Sphäre dar. c.) Literarische Diskurse des Depressiven sind im Gegensatz zu vor-modernen Melancholiediskursen nicht mit der Zuschreibung und Konstruktion von Genialität verbunden. d.) Der literarische Depressionsdiskurs der frühen Moderne kommt avant la lettre, in metaphorischer und umschreibender Form daher.
Zur Open-Access-Publikation „Ästhetik des Depressiven“, erschienen bei De GruyterFiguren der Diagnostik (in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Sabine Kyora, Uni Oldenburg)
Einen Ausgangspunkt dieses Projekts an der Schnittstelle von Literatur und Medizin bildet der Begriff der Diagnose. Die Hypothese lautet, dass literarische Texte zwischen der Mitte des 19. Jahrhunderts und dem ersten Drittel des 20. Jahrhunderts ‚diagnostische Schreibweisen‘ entwickeln und so Diagnostizieren als ein für die Moderne typisches Narrativ etablieren. Konkret werden literarische Texte auf ihren fachsprachlichen Gebrauch von Diagnose, Symptom und Therapie hin untersucht, wobei auch nach den gesellschaftlichen Praktiken des Diagnostizierens gefragt wird.
Der medizinische Fachterminus führt dabei in die metaphorische und narrative Verwendung, die auch in den Sozialwissenschaften im 20. Jahrhundert auftaucht (als Gesellschafts- oder Gegenwartsdiagnose). Unter dem Titel „Figuren der Diagnostik“ werden, erstens, literarische Figuren gefasst, die diagnostizieren oder denen eine Diagnose gestellt wird, zweitens, werden Figuren im Sinne rhetorischer Figuren und literarischer Verfahren als ‚diagnostische Schreibweisen‘ untersucht. Hinzu kommt, drittens, eine Analyse einschlägiger literarischer und außerliterarischer Autorinszenierungen. So werden mit Gottfried Benn, Hans Carossa, Alfred Döblin, Richard Huelsenbeck, Oskar Panizza und Arthur Schnitzler Autoren in den Blick genommen, die medizinisches Wissen verarbeiten und gesellschaftlich versteh- und übertragbar machen. Die als Ärzte ausgebildeten Schriftsteller realisieren als ‚Akteure des Diagnostizierens‘ dieses Muster in ihrem bürgerlichen Beruf fortwährend. Im Projekt werden dezidiert Gemeinsamkeiten zwischen Arzt- und Künstlerrolle herausgearbeitet. Im September 2021 fand in Oldenburg eine von der DFG geförderte internationale Tagung statt, darauf basierend entstand ein Sammelband, der in Kürze bei De Gruyter erscheint.
Re-Make, Re-Model, Re-Issue: Formen und Funktionen der Wiederveröffentlichung von Pop-Musik (in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Stefan Höppner, Uni Freiburg)
Das Projekt geht von der Beobachtung aus, dass Wiederveröffentlichungen auf dem Pop-Musik-Markt einen immer größeren Raum einnehmen. Ein Großteil der Re-Issues bezieht sich auf den kreativen Boom der Pop-Musik in der Zeit von ca. 1965 bis 1985. Derzeit verkaufen sich Deluxe-Ausgaben der Musik der 1960er und 1970er Jahre besonders gut, was auch an den finanziellen Möglichkeiten des (meist männlichen) Zielpublikums in einem Alter zwischen ca. 40 und 75 Jahren liegen mag.
Die Konjunktur der Re-Issues seit den 2000er Jahren lässt sich als Reaktion auf die Digitalisierung verstehen. Zugleich konstatieren manche Kritiker eine Art Stillstand hinsichtlich des Innovationspotenzials von Pop-Musik. Simon Reynolds spricht von einer „Retromania“, die in ihrer Rückwärtsgewandtheit innovative Tendenzen in der Pop-Musik überlagert oder diese durch einen dominanten Fokus auf das Archiv gar nicht erst zustande kommen lässt. Mark Fisher sieht den Rave und HipHop der 1990er Jahre als letzte popmusikalische Strömungen mit einem Anspruch auf ästhetische Innovation, die zugleich eine gesellschaftliche Utopie impliziert.
In diesem Projekt wird untersucht, welche Werke wiederveröffentlicht und somit kanonisiert werden. Darüber hinaus wird die jeweilige Form der Box-Sets untersucht, gerade auch im Hinblick auf eine spezifische Ästhetik der Wiederveröffentlichung. Welche Werke werden archiviert und im Rahmen des Re-Issues kommerzialisiert? Welche Medienformate, welche medialen Rahmungen und welche Vermarktungsstrategien werden genutzt? Und schließlich: welche gesellschaftlichen Zwecke erfüllt die Konjunktur der Wiederveröffentlichung?
Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Veröffentlichungen
Bücher
Figuren der Diagnostik. Literatur und Medizin. Hrsg. von Till Huber und Sabine Kyora. Berlin/Boston: De Gruyter 2025 [=Untersuchungen zur deutschen Literaturgeschichte, Bd. 179].Ästhetik des Depressiven. Hrsg. von Till Huber und Immanuel Nover. Berlin/Boston: De Gruyter 2023. [=spektrum Literaturwissenschaft, Bd. 78]. (Open-Access unter: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110776522/html?lang=de).
Blumfeld und die Hamburger Schule. Sekundarität – Intertextualität – Diskurspop. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2016 [= Westwärts. Studien zur Popkultur, Bd. 3].
Interview mit Andreas Müller, Deutschlandradio Kultur (27.08.2014)
Interview mit Sophia Wetzke, RBB/Radio Eins Berlin (21.04.2025)
Poetik der Oberfläche. Die deutschsprachige Popliteratur der 1990er Jahre. Hrsg. von Olaf Grabienski, Till Huber und Jan-Noël Thon. Berlin/Boston: De Gruyter 2011.
Aufsätze und Handbuchbeiträge
Autorschaft und Social Media [Art.]. In: Handbuch Literaturvermittlung. Hrsg. von Christoph Jürgensen und Julia Ingold. Berlin: Metzler 2027. „Living Edition“ abrufbar unter URL: https://link.springer.com/referencework/10.1007/978-3-662-67937-1
[mit Johannes Birgfeld und Innokentij Kreknin] Christian Kracht [Art./Essay]. In: Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. 145. Nachlieferung (2025).
[mit Sabine Kyora] Figuren der Diagnostik. Einleitenden Überlegungen. In: Figuren der Diagnostik. Literatur und Medizin. Hrsg. von Till Huber und Sabine Kyora. Berlin/Boston: De Gruyter 2025 [=Untersuchungen zur deutschen Literaturgeschichte, Bd. 179], S. 1–17.
Der unzuverlässige Autopathograph in Peter Kurzecks Mein wildes Herz. In: Figuren der Diagnostik. Literatur und Medizin. Hrsg. von Till Huber und Sabine Kyora. Berlin/Boston: De Gruyter 2025 [=Untersuchungen zur deutschen Literaturgeschichte, Bd. 179], S. 263–283.
Politik und ‚ästhetischer Turn‘ im NDW-Diskurs. In: Protestpop und Krautrock. Hrsg. von Markus Joch, Christoph Jürgensen und Gerhard Kaiser. Stuttgart: Metzler 2024 [=Kontemporär. Schriften zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, Bd. 18], S. 293–303.
Blumfeld [Art.]. In: Eine Kulturgeschichte der Popmusik. Hrsg. von Christoph Jürgensen und Gerhard Kaiser. Stuttgart: Metzler [im Druck].
Daft Punk, „Around the World“ [Art.]. In: Eine Kulturgeschichte der Popmusik. Hrsg. von Christoph Jürgensen und Gerhard Kaiser. Stuttgart: Metzler [im Druck].
[mit Immanuel Nover] Pop-Inszenierungen von psychischer Krankheit in Benjamin von Stuckrad-Barres Panikherz. In: Benjamin von Stuckrad-BarresPanikherz. Text – Poetik – Inszenierung. Hrsg. von Kai Bremer, Lisa Czolbe und Jasmin Plewka. Berlin u.a.: Peter Lang 2024 [Literarisches Leben heute, Bd. 10], S. 15–39.
[mit Immanuel Nover] Ästhetik des Depressiven. Gesellschaftliche und literarische Perspektivierungen. In: Ästhetik des Depressiven. Hrsg. von Till Huber und Immanuel Nover. Berlin/Boston: De Gruyter 2023, S. 1–22. (Open-Access unter: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110776522-001/html).
„Aus der Depression heraus erzählen“. Autofiktionales Schreiben in Benjamin Maacks Wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein und Thomas Melles Die Welt im Rücken. In: Ästhetik des Depressiven. Hrsg. von Till Huber und Immanuel Nover. Berlin/Boston: De Gruyter 2023, S. 197–221. (Open-Access unter: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110776522-010/html).
„Unsere Ästhetik ist die politische Effektivität“ – Pop- und Kunstfeindlichkeit im deutschen Politrock seit 1968. In: Die 1968er Jahre. Utopie und Desillusion in Literatur, Film und Musik. Hrsg. von Martina Kopf und Sascha Seiler. Heidelberg: Winter 2023 [=Intercultural Studies, Bd. 13], S. 125–136.
[mit Immanuel Nover] Von der Erschöpfung zur Depression. Überlegungen zu einer Ästhetik des Depressiven anhand von Lars von Triers Melancholia. In: Erschöpfungsgeschichten. Kehrseiten und Kontrapunkte der Moderne. Hrsg. von Jan Gerstner und Julian Osthues. Paderborn: Wilhelm Fink 2021 [= vita activa, Bd. 5], S. 189–207.
Das Ich und die Dinge – nach-avantgardistischer Konsumrealismus in Irmgard Keuns Das kunstseidene Mädchen. In: Realisms of the Avant-Garde. Hrsg. Von David Ayers, Moritz Baßler, Sascha Bru, Ursula Frohne und Benedikt Hjartarson. Berlin/Boston: De Gruyter 2020. [= European Avant-Garde and Modernism Studies, Bd. 6], S. 487–498.
Keine stabile Position in Sicht – Respondenz zu Julia Bertschik, „Oberflächenästhetik. Die Barbourjacke als zweite Haut in Christian Krachts Roman Faserland“ und Robert Hermann, „‚Nichts ist sinnlos.‘ Zum Verhältnis von Spiritualität und Postmoderne in den Romanen von Christian Kracht“]. In: Christian Krachts Ästhetik. Hrsg. von Heinz Drügh und Susanne Komfort-Hein. Stuttgart: Metzler 2019 [= Kontemporär. Schriften zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, Bd. 3]. S. 107–113.
Lyrics als Literatur [Problematisierungen und Forschungsfragen]. In: Handbuch Literatur & Pop. Hrsg. v. Moritz Baßler und Eckhard Schumacher [= Handbücher zur kulturwissenschaftlichen Philologie], Berlin/Boston: De Gruyter 2019. S. 229–246.
Heinz Strunk: Fleisch ist mein Gemüse (2004) [Exemplarische Analysen]. In: Handbuch Literatur & Pop. Hrsg. von Moritz Baßler und Eckhard Schumacher [= Handbücher zur kulturwissenschaftlichen Philologie]. Berlin/Boston: De Gruyter 2019. S. 576–590.
[mit Philipp Pabst] Mainstreamcover. Inszenierte Authentizität in Jochen Distelmeyers „Songs From the Bottom Vol I.“. In: Lyrik/lyrics. Songtexte als Gegenstand der Literaturwissenschaft. Hrsg. von Frieder von Ammon und Dirk von Petersdorff, Göttingen: Wallstein 2019. S. 329–369.
Wassertod zwischen Fin de Siècle und Frühexpressionismus. Alfred Döblins „Die Segelfahrt“ im Kontext. In: TEXT + KRITIK. Heft 13/14 Neufassung (2018): Alfred Döblin. Hrsg. von Sabine Kyora. S. 32–46.
[mit Haimo Stiemer] Die neuen Untoten. Zombies in Filmen und Serien. In: Pop. Kultur und Kritik 7.1 (2018). S. 146–157.
Diskurse des Murmelns. Intertextualität in Christian Krachts Erzählung Wie der Boodhkh in die Welt kam, und warum. In: Christian Kracht revisited. Irritation und Rezeption. Hrsg. von Matthias N. Lorenz und Christine Riniker. Berlin: Frank & Timme 2018. S. 687–703.
Lizenz zum Fabulieren. Topographischer Ästhetizismus in Christian Krachts und Eckhart Nickels Gebrauchsanweisung für Kathmandu und Nepal. In: Christian Krachts Weltliteratur. Eine Topographie. Hrsg. von Stefan Bronner und Björn Weyand, Berlin/Boston: de Gruyter 2018 [= Gegenwartsliteratur. Autoren und Debatten, Bd. 1]. S. 69–91.
Andere Texte. Christian Krachts Nebentexte zwischen Pop-Journalismus und Docu-Fiction. In: TEXT + KRITIK. Heft 216 (2017): Christian Kracht. Hrsg. von Christoph Kleinschmidt. S. 86–93.
The Interesting Ones: Hamburger Schule and the Secondariness of German Pop. In: Perspectives on German Popular Music. Hrsg. von Christoph Jacke und Michael Ahlers. Farnham: Ashgate 2017 [= Popular and Folk Music Series]. S. 135–139.
Glücksgestaltung [Essay zum Zusammenhang von Burnout/Depression und Design]. In: Pop. Kultur und Kritik 5.1 (2016). S. 76–87.
Im Abflussrohr der Zeit. Werner Riegels und Peter Rühmkorfs Heiße Lyrik (1956). In: Vom Heimatroman zum Agit-Prop. Essays zur Literatur Westfalens 1945–1975. Hrsg. von Moritz Baßler, Walter Gödden, Sylvia Kokot und Arnold Maxwill im Auftrag der Literaturkommission für Westfalen, Bielefeld: Aisthesis 2016. S. 100–105.
Theodor W. Adorno: Prismen. Kulturkritik und Gesellschaft (1955). In: KulturPoetik. Zeitschrift für kulturgeschichtliche Literaturwissenschaft 15.1 (2015) [Reihe „KulturKlassiker“]. S. 123–133.
Oben im Eck – Ein Star im Verborgenen. Holger Hiller und die Neue Deutsche Welle. In: Hidden Tracks. Das Verborgene, Vergessene und Verschwundene in der Popmusik. Hrsg. von Thorsten Schüller und Sascha Seiler. Würzburg: Königshausen & Neumann 2012. S. 31–48.
[mit Olaf Grabienski und Jan-Noël Thon] Auslotung der Oberfläche. In: Poetik der Oberfläche. Die deutschsprachige Popliteratur der 1990er Jahre. Hrsg. von Olaf Grabienski, Till Huber und Jan-Noël Thon. Berlin/Boston: De Gruyter 2011. S. 1–10.
Im Herzen der Uneigentlichkeit. Überlegungen zu Christian Krachts Nordkorea. In: Christian Kracht. Zu Leben und Werk. Hrsg. von Johannes Birgfeld und Claude D. Conter, Köln: Kiepenheuer & Witsch 2009. S. 223–237.
Ausweitung der Kunstzone. Ingo Niermanns und Christian Krachts ‚Docu-Fiction‘. In: Depressive Dandys. Spielformen der Dekadenz in der Pop-Moderne. Hrsg. von Alexandra Tacke und Björn Weyand, Köln/Weimar/Wien: Böhlau 2009 [= Literatur – Kultur – Geschlecht, kleine Reihe, Bd. 26]. S. 218–233.
„Ich will da nicht leben, wo es niemals Leben gab“. Der Diskurs-Pop der Sterne als ‚kapitalistischer Realismus‘. In: Stadt.Land.Pop. Popmusik zwischen westfälischer Provinz und Hamburger Schule. Hrsg. von Moritz Baßler, Walter Gödden, Jochen Grywatsch und Christina Riesenweber. Bielefeld: Aisthesis 2008. S. 132–153.
Rezensionen und Feuilletons (Auswahl)
Autoren auf Instagram. Das Versprechen der Unmittelbarkeit [Kolumne Marketing]. In: Pop. Kultur und Kritik 14.2 (2025), S. 108–113
BookTok [Kolumne Marketing]. In: Pop. Kultur und Kritik 13.1. (2024), S. 71–76.
Musik-Streamingdienste – Playlisten-Pop für Gestresste [Kolumne Marketing]. In: Pop. Kultur und Kritik 11.2 (2022), S. 42–47. Online veröffentlicht auf tagesspiegel.de unter: https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/musik-als-klangtapete-wie-streamingdienste-den-song-toten-8998819.html
Melancholische Marken [Kolumne Marketing]. In: Pop. Kultur und Kritik 10.1 (2021), S. 66-70. Online-Version unter: https://pop-zeitschrift.de/2024/03/26/melancholische-markenautorvon-till-huber-autordatum26-03-2024-datum/
Essay zu Rheingold, „Fluss“. In: NDW lesen. Hrsg. von Eckhart Nickel und Philipp Theisohn [im Druck].
SUV, Normcore, Smart, Elektroautos (Kolumne Marketing). In: Pop. Kultur und Kritik 8.2 (2019). S. 10–15. Online-Version unter: https://pop-zeitschrift.de/2019/10/21/suv-normcore-smart-elektroautosvon-till-huber21-10-2019/
Rezension zu Diedrich Diederichsen: Körpertreffer. Zur Ästhetik der nachpopulären Künste. Berlin: Suhrkamp 2017. In: Arbitrium 37.2 (2019). S. 266–271.
Superpunk: „Wasser Marsch!“. In: Damaged Goods. 150 Einträge in die Punkgeschichte. Hrsg. von Jonas Engelmann. Mainz: Ventil 2016. S. 319–321.
Zurück in die Dörfer. Christian Krachts Roman „Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten“ ist alternative Geschichtsschreibung. In: Literaturkritik.de 10 (2008). URL: http://literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=12379.
Auf dem Schulhof. Rezension zu „Lass uns von der Hamburger Schule reden. Eine Kulturgeschichte aus der Sicht beteiligter Frauen“, hrsg. von Jochen Bonz, Juliane Rytz und Johannes Springer, Mainz: Ventil, 2011. In: der Freitag 48 (2011). S. 16. URL: http://www.freitag.de/autoren/der-freitag/auf-dem-schulhof.
1 Die vollständige E-Mail-Adresse wird nur im Intranet gezeigt. Um sie zu vervollständigen, hängen Sie bitte ".uni-marburg.de" or "uni-marburg.de" an, z.B. musterfr@staff.uni-marburg.de bzw. erika.musterfrau@uni-marburg.de.