Prof. Dr. Hendrik Trescher
Universitätsprofessor
Kontaktdaten
+49 6421 28-23055 hendrik.trescher@ 1 Bunsenstraße 335032 Marburg
F|15 Institutsgebäude (Raum: 405 bzw. +4/0050)
Organisationseinheit
Philipps-Universität Marburg Erziehungswissenschaften (Fb21) Institut für Erziehungswissenschaft Sozial- und Rehabilitationspädagogik Inklusion und Exklusion (AG Trescher)Professur mit dem Schwerpunkt "Inklusion und Exklusion"
Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte
• Inklusionsforschung
• Raum- und gruppenbezogene Praxen und Prozesse von Teilhabe
• Pädagogik bei kognitiven Beeinträchtigungen (‚geistige Behinderung‘; ‚Demenz‘)
• Methoden qualitativer Sozialforschung
• Sozialwissenschaftliche Grundlagen der (Sonder-) Pädagogik
• Disability Studies, insbesondere Subjektgenese im Kontext von ‚Behinderung' und Marginalisierung
• Sozialraum- und kommunale Entwicklung im Kontext InklusionCurriculum Vitae
seit 10/2018 Professur
für Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt 'Inklusion und Exklusion' an der Philipps-Universität Marburg
04/2018 - 09/2018 Vertretung
der Professur für Allgemeine Rehabilitations- und Integrationspädagogik (zuletzt besetzt durch Andreas Hinz) an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg10/2013 - 09/2015 Vertretung
der Professur für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Sonderpädagogik, Fachbereich für Erziehungswissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt10/2012 - 03/2018 Wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Institut für Sonderpädagogik, Fachbereich für Erziehungswissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt10/2012 - 09/2015 Lehrbeauftragter
am Institut für Erziehungswissenschaft der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
10/2011 - 02/2012 Lehrbeauftragter
am Fachbereich für Erziehungswissenschaften der Goehte-Universität Frankfurt09/2011 - 10/2012 Wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Institut für Erziehungswissenschaft der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, am Lehrstuhl von Frau Prof. Dr. Evelyn Heinemann04/2009 - 09/2011 Projektmitarbeit
am interdisziplinären Forschungsprojekt „Lebensqualität im Pflegeheim“ der Universität Wien unter der Leitung von Prof. Dr. Anton Amann, Prof. Dr. Elisabeth Seidl und Prof. Dr. Wilfried Datler01/2009 - 12/2011 Projektmitarbeit
am Drittmittelprojekt ‚Adipositas im Kindes- und Jugendalter‘ des Instituts für hermeneutische Sozial- und Kulturforschung (IHSK) in Kooperation mit der Deutschen Sporthochschule Köln unter der Leitung von Prof. Dr. Ulrich Oevermann
Wissenschaftliche Ausbildung
2015 Habilitation / venia legendi für Erziehungswissenschaften
an der Goethe-Universität Frankfurt am Main2012 Promotion (Dr. phil.) in Erziehungswissenschaften
an der Goethe-Universität Frankfurt am Main in Kooperation mit der Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft der Universität Wien. Gesamtbewertung: „summa cum laude“
Gutachter: Prof. Dr. Dieter Katzenbach (Frankfurt); Prof. Dr. Wilfried Datler (Wien); Prof. Dr. Detlef Garz (Mainz)2010: Diplom in Soziologie
bei PD Dr. Oliver Schmidtke2009: Diplom in Pädagogik
bei Prof. Dr. Ulrich Oevermann10/2004 - 05/2010 Studium
der Erziehungswissenschaften, Soziologie, Psychologie, Sozialpsychologie, pädagogischen Psychologie, Geschichtswissenschaft und europäischen Ethnologie an der Albert Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau, der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main und der Universität WienForschungsprojekte
Laufende Projekte:
Freizeit als Fenster zur Inklusion - 10 Jahre später
2024-aktuell
In der multimethodisch angelegten Studie "Freizeit als Fenster zur Inklusion. Konstruktionen von Teilhabe und Ausschluss für erwachsene Menschen mit ‚geistiger Behinderung‘" (mehr zum Projekt siehe unten unter abgeschlossene Projekte) wurden im Jahr 2015 Möglichkeiten untersucht, wie es gelingen kann, Menschen mit ‚geistiger Behinderung‘ eine inklusive Teilhabe am gesellschaftlichen Strukturbereich ‚Freizeit‘ zu ermöglichen.
Erforscht wurden u.a. der zu diesem Zeitpunkt aktuelle Stand der Teilhabe von Menschen mit ‚geistiger Behinderung‘ an Freizeitaktivitäten, die prinzipiellen Möglichkeiten und die damit möglicherweise verbundenen manifesten sowie (potenziell) latenten Teilhabebarrieren.
Genau 10 Jahre später wird dieser Teilbereich des Projektes nun mit einer Folge- bzw. Vergleichsstudie erneut aufgegriffen, um Aussagen darüber treffen zu können, was sich in der Zwischenzeit verändert hat.Disziplinbezogene Biographieforschung
Vrsl. Laufzeit: 01.07.2023 bis aktuell
Zusammen mit Dr. Michael Börner
Im Projekt „Disziplinbezogene Biographieforschung“ wird das Erkenntnisinteresse auf die (ehemalige) Studierendenschaft des Studiengangs „Erziehungs- und Bildungswissenschaft“ der Philipps-Universität Marburg gerichtet. Über biographische Interviews und die Verschränkung verschiedener Auswertungsmethoden (Objektive Hermeneutik & Qualitative Inhaltsanalyse) werden biographische Verläufe, Lebensentwürfe und Selbstkonstruktionen von (ehemaligen) Studierenden der „Erziehungs- und Bildungswissenschaft“ beleuchtet sowie der Rolle bzw. Bedeutung des Studienstandorts Marburg nachgegangen. Relevante Fragen sind zum Beispiel die nach der sozialen Herkunft, biographischen Gründen für die Wahl des Studiums (in Marburg) und dessen je konkrete Ausgestaltung sowie beruflichen Perspektiven insgesamt.
Das Projekt ist als Lehrforschungsprojekt konzipiert, d.h. es wird gemeinsam mit aktuellen Studierenden des BA- und MA-Studiengangs geplant und umgesetzt.Kommune inklusiv
2017-2032 Aktion Mensch
Die wissenschaftliche Begleitung des Projekts „Kommune inklusiv“ soll auf drei Ebenen die Wirkung des Projekts auf den jeweiligen Sozialraum untersuchen. Ebene 1 des Vorhabens sieht die Wirkungsanalyse des Gesamtprozesses (Evaluierung der Leistungsmodule) vor und Ebene 2 die Wirkungsanalyse des Vernetzungs- und Umsetzungsprozesses in den fünf ausgewählten Sozialräumen (Sozialraum-Monitoring und Sozialraumanalyse). Methodisch wurde diesbezüglich ein Mixed-Methods-Design entwickelt, das quantitative und qualitative Sozialforschungsmethoden sinnvoll und gewinnbringend miteinander verschränkt. Ebene 3 stellt das subjektive Erleben und die subjektiven Einschätzungen aller am Prozess beteiligten AkteurInnen in den Fokus. Dementsprechend sollen in jeder Kommune und zu jedem Handlungsfeld vertiefende, längsschnittlich angelegte Einzelfallstudien erstellt werden.
Zum ProjektAbgeschlossene Projekte:
Sexualität und Behinderung
2023-2024 Philipps-Universität Marburg
Die Studie "Sexualität und Behinderung" folgt der Forschungsfrage, wie Menschen mit 'Behinderung' ihre Sexualität ausleben, erleben und, was diese für sie bedeutet. Dafür werden Interviews mit verschiedenen Menschen mit 'Behinderung' geführt (Themen sind hierbei bspw.: Partner*innensuche, Beziehungsformen, Umgang mit dem eigenen Geschlecht und/oder der Sexualität, Bedarfe von Unterstützung/Assistenz im Kontext Sexualität oder die Frage, inwiefern pädagogische Institutionen und/oder die Herkunftsfamilie eine möglichst selbstbestimmte Sexualität hemmen und/oder fördern, etc.). Abschließend soll eine Aussage darüber getroffen werden, was die Ergebnisse für das pädagogische Handeln bedeuten. Die Studie wird u.a. als Lehrforschungsprojekt realisiert.Fort- und Weiterbildungsbedarfe für Mitarbeitende der Behindertenhilfe im Kontext der Betreuung von Menschen mit 'geistiger Behinderung'
2023-2024 Philipps-Universität Marburg
In dieser Studie wird mithilfe eines bundesweiten Surveys wissenschaftlich ermittelt, inwiefern ein Fort- und Weiterbildungsbedarfe im Kontext der Betreuung von Menschen mit 'geistiger Behinderung' für Personal und Angestellte der Behindertenhilfe besteht. Ziel ist es, fundierte Ergebnisse über solche Fort- und Weiterbildungsbedarfe zu erlangen und diese der Praxis und der wissenschaftlichen Community zur Verfügung zu stellen. Auf Basis der Ergebnisse können perspektivisch Fort- und Weiterbildungen implementiert werden, die auf die spezifisch ermittelten Bedarfe angepasst sind.Institutionalisierte Lebensbedingungen in Zeiten von Corona
2020-2021 Philipps-Universität Marburg in Kooperation mit Lebenshilfe Frankfurt am Main e.V.
In der Studie „Institutionalisierte Lebensbedingungen in Zeiten von Corona“ werden die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, bzw. die der in dem Kontext getroffenen Maßnahmen, auf die Lebensrealitäten institutionalisiert lebenden Menschen untersucht. Die Studie wird als Lehrforschungsprojekt realisiert. Anhand gesprächsförmiger Topic-Interviews mit MitarbeiterInnen unterschiedlicher Institutionen wird dem Forschungsinteresse nachgegangen.
Zum ProjektLeichte Sprache im (inter-)nationalen Forschungsdiskurs
2019-2022 Forschungsförderfonds der Philipps-Universität Marburg
In der Studie „Leichte Sprache im (inter-)nationalen Forschungsdiskurs“ wird untersucht, inwiefern Leichte Sprache in englisch- und deutschsprachigen Fachzeitschriften, Monographien, Sammelbandbeiträgen und anderen Fachveröffentlichungen thematisiert wird. Methodisch wird sich dabei an der Studie „Kognitive Beeinträchtigung und Barrierefreiheit“ (Trescher 2018) orientiert. Zudem handelt es sich um eine Sekundärauswertung, da in Teilen derselbe Materialkorpus analysiert wird.
Zum ProjektZwischen Herkunftsfamilie und dem Leben im ambulant betreuten Wohnen
2018-2023 Lebenshilfe Frankfurt am Main e.V. und Goethe-Universität Frankfurt
In der Studie „Zwischen Herkunftsfamilie und dem Leben im ambulant betreuten Wohnen“ werden Lebensräume und Lebensperspektiven von Menschen mit ‚Lernschwierigkeiten‘ untersucht, die in unterschiedlichen ambulant betreuten Wohnformen leben. Die Studie wird als zweisemestriges Lehrforschungsprojekt und in Kooperation mit der Lebenshilfe Frankfurt am Main e. V. realisiert.
Zum ProjektInklusion als Herausforderung integrativer Kindertageseinrichtungen
2017-2020 Lebenshilfe e.V.
Das Forschungsvorhaben sucht, gemeinsam mit der Lebenshilfe Frankfurt e.V., die Lebenspraxis innerhalb von sog. ‚integrativen Kindertageseinrichtungen‘ zu beleuchten. Hierfür werden drei strukturell kontrastive Kindertageseinrichtungen des Kooperationspartners in den Blick genommen und auf drei Ebenen untersucht: a) Ebene der pädagogischen Fachkräfte (MitarbeiterInnen-Interviews), b) Ebene der Interaktion (ethnographische Beobachtungen), c) Ebene der strukturellen Begebenheiten (Analyse von Handlungskonzepten, baulichen Strukturen usw.). Ziel des auf zwei Semester ausgelegten Projekts ist es, über die drei gewählten Zugänge einen möglichst umfassenden Einblick in die Lebenspraxis der Einrichtungen zu bekommen und diese vor dem Hintergrund der Forderung nach Inklusion kritisch zu reflektieren. In diesem Zusammenhang ist es der Anspruch des Vorhabens, die herausgearbeiteten Ergebnisse auf unterschiedlichen Wegen wieder in die Handlungspraxis zurück zu geben.
Zum ProjektBarrierefreiheit für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung
2017-2018 Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Die übergeordnete Fragestellung des Vorhabens ist: Worin liegen Barrieren der Teilhabe für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen und welche Studien gibt es bereits zu dieser Thematik? Forschungspraktisch sollen in einem ersten Schritt nationale und internationale Studien und Veröffentlichungen zum Thema ‚Kognitive Beeinträchtigung und Barrierefreiheit‘ zusammengetragen werden, um aus diesem Forschungsdiskurs noch offene bzw. weiterführend zu beforschende Fragestellungen abzuleiten, welche dann in einem anschließenden Forschungsprojekt (Hauptstudie) untersucht werden sollen. Dazu werden umfängliche Literaturrecherchen in (a) bezugsrelevanten Fachzeitschriften und (b) Publikationen wie bspw. Monographien oder Forschungsberichten sowohl aus dem nationalen als auch internationalen Diskurs durchgeführt, wobei der Zeitraum der letzten zehn Jahre abgedeckt wird. Die Operationalisierung der Recherchen sieht vor, sich der Thematik in (zunächst) acht Bereichen zu nähern, um so möglichst umfassend relevante Lebensbereiche abdecken zu können. Die Bereiche sind: Freizeit, Arbeit, Schule und Bildung, Wohnen, Alltag, Politische Partizipation, Behörden/Ämter/Öffentliche Verwaltung sowie Sozialräume und Mobilität.
In einem zweiten Schritt sollen 40 halbstandardisierte ExpertInneninterviews mit Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung geführt werden, um Problemfelder in der Praxis erkennen zu können. Die Ergebnisse der Interviews mit diesen ‚ExpertInnen in eigener Sache‘ sollen zu einer Kontrastierung der Recherchen herangezogen werden.
Zum ProjektWohin mit dem Wohnheim? – Institutionsanalyse und Organisationsentwicklung in der Stationären Behindertenhilfe
2016-2017 Lebenshilfe e.V.
Die Gestaltung und Organisation stationärer Wohnformen stellt eine zentrale Herausforderung der Behindertenhilfe dar. Gemeinsam mit der Lebenshilfe Frankfurt e.V. sollen Wohnheimstrukturen analysiert und alle Ergebnisse praxisnah rückgekoppelt werden. Ziel dabei ist es, die individuellen Wohnbedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner stationärer Einrichtungen in den Mittelpunkt zu stellen. Daneben werden zusätzlich Perspektiven professionell Tätiger erfasst, die den Lebensraum Heim mit entstehen lassen. Als dritte Perspektive werden objektive Vorgaben, diese reichen von baulichen Gegebenheiten, über konzeptionelle Vorgaben des Trägers bis hin zu Verordnungen, die durch Kostenträger vorgegeben werden, miteinbezogen.
Das Projekt versteht sich einerseits als Forschungsunternehmen im Bereich der sonderpädagogisch-sozialwissenschaftlichen Grundlagenforschung, andererseits aber auch als Praxisprojekt, da insbesondere durch den ständigen dialogischen Austausch aller Beteiligten, Wohnkonzepte neu gedacht und schlussendlich auch entwickelt werden sollen.
Zum ProjektLebensentwürfe von Menschen mit geistiger Behinderung
2015-2017 Praunheimer Werkstätten gGmbH
Gegenständlich sollen Biographien von erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung rekonstruiert werden. Neben Menschen, die darüber selbst Auskunft geben können, sollen explizit auch Biographien von Menschen rekonstruiert werden, die als 'nicht verbalsprachlich' gelten. Dazu wird sich mit Biographien einer möglichst heterogenen Gruppe von Menschen mit geistiger Behinderung beschäftigt. Dies reicht von Klienten aus dem Bereich 'Ambulant Betreutes Wohnen' bis zu Klienten einer 'Intensiv-Wohngruppe', betrifft Männer und Frauen, Menschen, die noch bei den Eltern und solche, die in der eigenen Wohnung leben, junge Erwachsene, die in einer Tagesförderstätte tätig sind, werden ebenso beforscht, wie ältere, berentete Menschen. Besondere Foki sind dabei a) Ablösungskonflikte und die Rolle der Herkunftsfamilie, b) Persönlichkeitsentwicklung und Zukunftsperspektiven, insbesondere auch im Kontext von institutionalisierten Betreuungsstrukturen. Aufbauend auf den Ergebnissen sollen Strategien entwickelt werden, Menschen mit (schwerer) geistiger Behinderung pädagogisch so zu unterstützen, um individuelle Lebens- und Zukunftsentwürfe bestmöglich zu entwickeln bzw. zu realisieren.
Zum ProjektInklusion: Politische Partizipation von Menschen mit Behinderung in Deutschland (Expertise / Gutachtenauftrag)
2016 Deutsches Institut für Menschenrechte
Inwiefern partizipieren Menschen mit Behinderung am politischen Leben in Deutschland? Dies war die zentrale Fragestellung des Projekts, welches im Auftrag des Deutschen Instituts für Menschenrechte durchgeführt wurde. Gegenständlich ging es darum, herauszufinden, ob Menschen mit Behinderung am politischen Leben in Deutschland partizipieren und wenn ja, in welchem Maße. Außerdem interessierte, inwieweit und wodurch ihre Partizipation möglicherweise beschränkt wird. Zentral war hier a) die Ebene des Informationszugangs, also die Frage danach, ob Menschen mit Behinderung gleiche Möglichkeiten haben, sich über Politik und gesellschaftliches Leben zu informieren. Weiterhin wurde auf einer zweiten Ebene b) der Frage nachgegangen, inwiefern Menschen mit Behinderung tatsächlich ihr aktives Wahlrecht wahrnehmen und wo hierbei immer noch Barrieren zu identifizieren sind. Darüber hinaus wurde sich auf einer dritten Ebene c) damit auseinandergesetzt, inwiefern Menschen mit Behinderung ihr passives Wahlrecht ausüben. Auch hier galt es, mögliche Barrieren zu identifizieren. Abschließend wurden verschiedene politische und rechtliche Handlungsoptionen diskutiert, um Menschen mit Behinderung mehr politische Partizipation zu ermöglichen. Die Expertise floss in den unabhängigen Bericht zur Umsetzung von OSZE-Verpflichtungen zu Menschenrechten und Demokratie ein, den das Deutsche Institut für Menschenrechte im Auftrag des Auswärtigen Amtes erstellte.
Näheres zur Expertise
Gesamtbericht und Expertise als PDF (S.96-108)Freizeit als Fenster zur Inklusion. Konstruktionen von Teilhabe und Ausschluss für erwachsene, institutionalisiert lebende Menschen mit ‚geistiger Behinderung‘
2013-2015 Praunheimer Werkstätten gGmbH
Mittels eines mehrstufigen, multimethodalen Forschungssettings wurden Möglichkeiten erörtert, wie es gelingen kann, Menschen mit ‚geistiger Behinderung‘ inklusiv am gesellschaftlichen Strukturbereich ‚Freizeit‘ teilhaben zu lassen bzw. Menschen mit ‚geistiger Behinderung‘ in ‚normale‘ Freizeitaktivitäten einzubinden. Dabei wurden a) prinzipielle Möglichkeiten und damit eventuell verbundene manifeste sowie (potenzielle) latente Teilhabebarrieren erforscht, b) der Alltag von Menschen mit ‚geistiger Behinderung‘ und deren Bedürfnisse dahingehend untersucht, welche Möglichkeiten/Hemmungen/Wünsche etc. auf Seiten der Rezipienten bestehen und c) die Rolle, die eine Versorgungsinstitution hinsichtlich der Freizeit- und Lebensgestaltung der Klienten spielt, einer kritischen Betrachtung unterzogen.
Zum ProjektWohnräume als pädagogische Herausforderung. Institutionelle Alltagsgestaltung in Einrichtungen für Menschen mit ‚geistiger Behinderung‘
2014-2015 Praunheimer Werkstätten gGmbH
Mittels eines mehrstufigen, multimethodalen Forschungssettings wurde die Wohnsituation von institutionalisiert lebenden Menschen mit geistiger Behinderung untersucht. Zentral zu untersuchende Aspekte waren dabei: a) Individualität und Gemeinschaftsleben, b) die Bedeutung des Privaten, c) der institutionelle Rahmen, d) Alltagserleben, e) Wohnen und Freizeit. Besonderer Fokus lag dabei auch auf Menschen mit verbalsprachlichen Beeinträchtigungen. Dies erforderte methodisch, dass neben Interviews insbesondere Alltagsbeobachtungen durchgeführt werden mussten. Aufbauend auf den Analysen der entstandenen Protokolle wurden gemeinsam mit dem Kooperationspartner (Praunheimer Werkstätten gGmbH) mögliche Handlungsoptionen eruiert, um die Lebenssituation von institutionalisiert lebenden Menschen mit geistiger Behinderung allen Alters zu verbessern.
Zum ProjektMediale Repräsentanz von geistiger Behinderung
2015
In Diskursen werden Repräsentanzen von Gegenständen, Personen oder Sachverhalten hervorgebracht, die die öffentliche Wahrnehmung beeinflussen und zur Meinungsbildung beitragen. Medien können dabei als Aufführungsort öffentlicher Diskurse verstanden werden, die eine je spezifische Inszenierung ihres jeweiligen Gegenstands vornehmen. Das so produzierte öffentliche ‚Bild‘ zieht wiederum entsprechende Praxen nach sich. Mit Blick auf den hiesigen Gegenstand heißt das, dass davon ausgegangen wird, dass die mediale Darstellung von Menschen mit geistiger Behinderung Auswirkungen darauf hat, wie in der Öffentlichkeit Menschen mit geistiger Behinderung begegnet wird. Es interessiert hier also die Frage, inwiefern die Repräsentanz von Menschen mit geistiger Behinderung, beispielsweise in gängigen Zeitschriften oder Zeitungen, zu einer (Re)Produktion von behinderungsspezifischen Praxen beitragen. Insgesamt wurden so 20 Print- und Onlinemedien aus den Bereichen ‚Qualitätspresse‘ (Tages-/Wochenzeitungen), ‚Boulevardpresse‘ (z.B. Brigitte, Super Illu) sowie ‚Magazine‘ (z.B. NEON, Spiegel) anhand sequenzanalytischer Verfahren untersucht. Analysefokus war dabei die Frage danach, wie Menschen mit geistiger Behinderung in den jeweiligen Medien dargestellt werden.
Zum ProjektDemenz und Diskurs
2013-2014
Ziel war es, die Pflege- und Betreuungssituation demenziell erkrankter Menschen als kulturelle Diskurspraxis bzw. Vollzug normativer Diskurse am dementen Subjekt nachzuweisen und bestehende Diskursteilhabebarrieren aufzuzeigen. Hierzu wurden leitfadengestützte Interviews mit ExpertInnen aus dem beruflichen Umfeld der psychosozialen Betreuung und Pflege von Menschen mit Demenz geführt. Forschungsleitend war dabei die Frage, inwieweit die Handlungspraxis in der Demenzversorgung dem sonderpädagogischen Paradigma der Selbstbestimmung gerecht wird. Es handelte sich um eine Vorstudie zu einem breiter angelegten Forschungsprojekt, in dem sonderpädagogische Zugänge zu Demenz auf Basis diskursanalytischer Dekonstruktion der öffentlichen sowie naturwissenschaftlich-medizinischen Wahrnehmung von Demenz erschlossen werden sollen.
Zum ProjektTOLL-Magazin für Wundertage
2013-2015
Ziel war es, ein Print- und Online-Magazin von und mit Menschen mit ‚geistiger Behinderung‘ zu etablieren, um bestehende Diskursteilhabebarrieren abzubauen. Ausgehend von der Annahme, dass das öffentliche Bild von ‚geistiger Behinderung‘ noch immer stark durch tradierte Ansichten und Vorurteile geprägt ist und dort primär als pathologische Abweichung von einer gesellschaftlichen Norm definiert wird, suchte das Forschungsunternehmen nach Wegen und Potenzialen des Aufbruchs jener Denktraditionen. Gegenständlich ging es um die Begleitung und Evaluation des Magazins „TOLL – Magazin für Wundertage“ (http://www.toll-magazin.de/). Handlungsleitende Intention war es, über dessen feste Etablierung ein Sprachrohr bzw. ein Stück Diskursteilhabe für Menschen mit ‚geistiger Behinderung‘ zu schaffen und mit einer Redaktion, in welcher vorwiegend Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen tätig sind, einen Ort der Selbstrepräsentanz zu eröffnen. Mittels eines mehrschichtigen, multimethodalen Forschungssettings wurden eine qualitative sowie eine quantitative Wirkungsstudie zum Magazin durchgeführt, um dessen Potenziale zu erörtern. Anschließend wurden Experteninterviews mit Medienfachleuten und Menschen mit ‚geistiger Behinderung‘ geführt, um einerseits die Potenziale der Selbstrepräsentanz bewerten zu lassen und andererseits die Wirkung des Magazins bei der Gruppe der Repräsentierten zu überprüfen.
Zum ProjektTeam
Mitarbeitende
• Sonja Weidmann, MA
• Silvia Rügner, MA, Stipendiatin
• Oliver Bocks, AdministrationEhemalige Mitarbeitende
• Peter Nothbaum, MA, wissenschaftlicher Mitarbeiter
• Dr. phil. Michael Börner, MA
• Dr. phil. Teresa Hauck
• Anna Lamby, MAVeröffentlichungen
Monografien
Trescher, Hendrik/ Nothbaum, Peter 2025: Fort- und Weiterbildungsbedarfe im Kontext der Betreuung von Menschen mit ‹geistiger Behinderung›.
Marburg : Lebenshilfe Verlag der Bundesvereinigung.
Volltext/Open Access | Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik (2025): Eltern von (erwachsenen) Kindern mit geistiger Behinderung. Erfahrungen, Probleme, Bedarfe.
Marburg : Lebenshilfe Verlag der Bundesvereinigung.
Volltext/Open Access | Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik/ Börner, Michael (2023): Inklusion als Herausforderung für integrative Kindertageseinrichtungen.
Weinheim Basel: Beltz Juventa.
Link | Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik/ Hauck, Teresa (2020): Inklusion im kommunalen Raum. Sozialraumentwicklung im Kontext von Behinderung, Flucht und Demenz.
Bielefeld: transcript.
Rezension auf socialnet | Volltext über Research Gate | Volltext/Open Access | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik (2018): Ambivalenzen pädagogischen Handelns. Reflexionen der Betreuung von Menschen mit „geistiger Behinderung“.
Bielefeld: transcript.
Volltext/Open Access | Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik (2018): Kognitive Beeinträchtigung und Barrierefreiheit. Eine Pilotstudie.
Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
Volltext/Open Access | Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik (2017): Behinderung als Praxis. Biographische Zugänge zu Lebensentwürfen von Menschen mit „geistiger Behinderung“.
Bielefeld: transcript.
Rezension von Tobias Buchner (2018). In: Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften 40 (2).
Rezension auf socialnet | Volltext/Open Access |Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik (2016): Wohnräume als pädagogische Herausforderung. Zur Lebenssituation institutionalisiert lebender Menschen mit Behinderung.
Wiesbaden: VS.
Rezension auf socialnet | Volltext über Springerlink | Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik (2015): Inklusion. Zur Dekonstruktion von Diskursteilhabebarrieren im Kontext von Freizeit und Behinderung.
Wiesbaden: VS.
Rezension auf socialnet | Volltext über Springerlink |Volltext über Research Gate | Volltext über Academia
Ausgezeichnet mit dem Forschungspreis der Deutschen Interdisziplinären Gesellschaft zur Förderung der Forschung für Menschen mit geistiger Behinderung 2016.Trescher, Hendrik (2013): Kontexte des Lebens. Lebenssituation demenziell erkrankter Menschen im Heim.
Wiesbaden: VS.
Volltext über Springerlink | Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaZeitschriftenbeiträge
Trescher, Hendrik/ Weidmann, Sonja (2025): Selbstbestimmt Freizeit erleben – mehr Inklusion bei Freizeitangeboten?
In: Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, (SZH) 31(07), S. 33-38.
Online Volltext | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik/ Nothbaum, Peter (2025): Weiterbildungsbedarfe im Kontext der Betreuung von Menschen mit »geistiger Behinderung«.
In: Behindertenpädagogik 64(2), S. 155-171.
Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik/ Nothbaum, Peter (2025): Further Education in the Care of Individuals with Intellectual Disabilities: Findings from a Nationwide Online Survey in Germany.
In: Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji- MPER (Multidisciplinary Approaches in Education and Rehabilitation- MPER), 7(9), S. 13-28.
Online Volltext | Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaBörner, Michael/ Trescher, Hendrik (2024): Inklusion als Auftrag. Praxen von Teilhabe und Ausschluss in Kindertageseinrichtungen.
In: ARCHIV für Wissenschaft und Praxis der Sozialen Arbeit, 55(04), S. 50-60.
Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik/ Weidmann, Sonja (2024): Attitudes towards inclusion in the context of ‘intellectual disability’: Demographic characteristics of attitude types and how social privileges might lead to denying inclusion.
In: Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji- MPER (Multidisciplinary Approaches in Education and Rehabilitation- MPER), 6(8), S. 61-72.
Online Volltext | Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik (2024): Einrichtungen während der Corona-Pandemie. Restriktionen und irritierte Routinen als Chance für Veränderung?
In: Neue Praxis 54(2), S. 157-171.
Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik (2024): Sind Inklusionsprojekte (noch) pädagogisch?
In: Behindertenpädagogik 63(2), S. 146-165.
Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaMehringer, Victoria/ Trescher, Hendrik (2023): Der Übergang der Fluchtmigration bei Familien mit einem Kind mit Behinderung.
Eine Lebenspraxis zwischen komplexen Wechselwirkungen von Diskursteilhabebarrieren.
In: Behindertenpädagogik, 62(3), S. 270-278.
Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik/ Nothbaum, Peter (2023): Pädagogische Perspektiven auf sexuelle Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung.
In: Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, (SZH) 29(06), S. 2-7.
Volltext | Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik/ Börner, Michael/ Nothbaum, Peter (2023): Inklusion als Projekt. Herausforderungen und Ambivalenzen inklusionsbezogener Projektarbeit und -begleitung am Beispiel von „Kommune Inklusiv“.
In: Neue Praxis, 53(3), S. 232-239.
Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik/ Börner, Michael (2022): Die Krise als konstitutives Moment pädagogischer Professionalität. Zur Wiederentdeckung und Würdigung der Krisenhaftigkeit pädagogischen Handelns am Beispiel integrativer Kindertageseinrichtungen.
In: Transfer Forschung Schule, 8(1), S. 162-175.
online Volltext | Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaBörner, Michael/ Trescher, Hendrik (2022): Leben im Heim als Entfremdungserfahrung - Autobiografische Selbstkonstruktionen von Menschen mit geistiger Behinderung im höheren Lebensalter.
In: Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, (SZH) 28(7-8), S. 17-21.
online Volltext | Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik/ Nothbaum, Peter (2022): Zur Komplexität der Herausforderung selbstbestimmter Sexualität bei Menschen mit ‚geistiger Behinderung‘.
In: Inklusion jetzt!, Newsletter Oktober, S. 7-10.
Volltext über Research Gate | Volltext über Academia | Volltext über Inklusion jetzt!Trescher, Hendrik/ Nothbaum, Peter (2022): Institutionalisierte Lebenslagen von Menschen mit geistiger Behinderung und Perspektiven pädagogischen Handelns während der COVID-19-Pandemie.
In: Behindertenpädagogik, 61(2), S. 137-157.
Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik/ Nothbaum, Peter (2021): Institutionalisierte Lebensbedingungen und die Frage nach Inklusion in Zeiten von Corona.
In: Zeitschrift für Inklusion, 15(3).
online VolltextTrescher, Hendrik/ Hauck, Teresa (2021): Sozialraum und Inklusion – Ethnographische Sozialraumbegehungen zur raumbezogenen Rekonstruktion von Teilhabe und Ausschluss.
In: Sozialraum.de, 13(2).
online VolltextTrescher, Hendrik/ Hauck, Teresa (2021): Eltern von (erwachsenen) Kindern mit komplexen (Seh-) Beeinträchtigungen.
In: Blind-sehbehindert, 141(2), S. 161-167.
Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik (2021): Ambivalenzen Leichter Sprache.
In: Zeitschrift für Inklusion, 15(1).
online VolltextTrescher, Hendrik/ Lamby, Anna/ Börner, Michael (2020): Einstellungen zur Inklusion von Menschen mit geistiger Behinderung in Deutschland.
Erkenntnisse einer bevölkerungsrepräsentativen Studie.
In: Teilhabe, 59(3), S. 102-107.
Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik (2020): Pädagogisches Handeln methodisch reflektieren.
Entwicklung einer Reflexionsfolie nicht nur für die Praxis.
In: Menschen, 43(2), S. 53-59.
Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik/ Lamby, Anna/ Börner, Michael (2020): Einstellungen zu Inklusion im Kontext "geistiger Behinderung".
Lebensbereiche Freizeit, Arbeit und Wohnen im Vergleich.
In: Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik (SZH), 26(2), S. 13-19.
online Volltext | Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik/ Hauck, Teresa (2020): Behindernde Räume.
In: Gemeinsam leben, 28(2), S. 105-113.
Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik (2020): Eltern und ihre Kinder mit geistiger Behinderung im Hilfesystem.
Wie gouvernementale Praxen Familie hervorbringen.
In: Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete (VHN), 89(1), S. 150-164.
Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik/ Hauck, Teresa (2020): Zwischen Teilhabe und Ausschluss. Eltern und ihre erwachsenen Kinder mit geistiger Behinderung.
In: Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik (SZH), 26(1), S. 37-43.
online Volltext | Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik (2020): Leichte Sprache und Barrierefreiheit.
In: Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik (SZH), 26, S. 48-54.
online Volltext | Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik / Börner, Michael (2019): Empowerment und Inklusion - Zur (Un)Vereinbarkeit zweier Paradigmen.
In: Behindertenpädagogik, 58(2), S. 137-156.
Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaGrosche, Michael / Gottwald, Claudia / Trescher, Hendrik (2019): Editorial: Diskurs in der Sonderpädagogik – Sonderpädagogik im Diskurs.
In: Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete (VHN), 88(1), S. 8-10.
Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik (2018): Inklusion und Dekonstruktion.
Die Praxis der ‚Versorgung‘ von Menschen mit Behinderung in Deutschland zum Gegenstand.
In: Zeitschrift für Inklusion, 12 (2) online.
online Volltext/Open AccessTrescher, Hendrik / Hauck, Teresa (2018): Ambivalences of Inclusion in Day Care Centers for Children with and without Disabilities.
In: International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE), 5(12), S. 51-61.
online VolltextTrescher, Hendrik (2018): Accessibility for people with cognitive disabilities.
An international literature review.
In: Journal of Education & Social Policy, 5(3), S. 60-68.
online VolltextTrescher, Hendrik (2018): Inklusion zwischen Dekategorisierung und Dekonstruktion.
In: Pädagogische Differenzen, 1(1), S. 79-90.
Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik (2018): Inklusion in der Kita.
Eine Krise, die keine sein darf?
In: Der pädagogische Blick, 26(3), S. 176-187.
Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik (2018): Inklusion zwischen Theorie und Lebenspraxis.
In: Journal für Psychologie, 26(2), S. 29-49.
online Volltext | Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik/ Hauck, Teresa (2018): "Kommune inklusiv" - Sozialräume beforschen und begleiten.
In: Teilhabe 57(4), S. 156-162.
Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik (2018): Selbstbestimmung. Ambivalenzen pädagogischen Handelns.
In: Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik (SZH), 24(7-8), S. 6-12.
online Volltext | Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik (2018): Politische Partizipation von Menschen mit Behinderungen.
In: Behindertenpädagogik, 57(2), S. 165-177.
Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik (2018): Barrierearme Mobilität und kognitive Beeinträchtigung.
Stand der Forschung.
In: Teilhabe, 57(2), S. 63-67.
Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik (2018): Kritik zwischen Empirie, Theorie und Praxis.
Praxisforschung im Kontext‚ Freizeit und geistige Behinderung‘.
In: Zeitschrift für Diversitätsforschung und -management, 3(2), S. 157-169.
online LinkTrescher, Hendrik (2017): Inclusion as Critique. Deconstructionist Approaches Exemplified through ‘Care’ of People with Cognitive Disabilities in Germany.
In: International Journal of Social Science Studies (IJSSS), 5(8), S. 33-43.
online Volltext/Open AccessTrescher, Hendrik/ Hauck, Teresa (2017): Raum und Inklusion.
Zu einem relationalen Verhältnis.
In: Zeitschrift für Inklusion, 11(4), online.
online VolltextTrescher, Hendrik (2017): Disabling Practices.
In: Cogent Social Science, 3(1).
online Volltext/Open AccessTrescher, Hendrik (2017): Lebensentwürfe von Menschen mit „geistiger Behinderung“.
In: Behinderte Menschen, 40(1), S. 47-52.
online LinkTrescher, Hendrik (2017): Demenz - Kritische Analysen, pädagogische Reflexionen.
In: Behinderte Menschen, 40(3), S. 47-52.
- Zweitabdruck 2018 in: Sonderpädagogik in Niedersachsen 46 (3), S. 72-78.
Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik (2017): Subjektivierungspraxen in der stationären Behindertenhilfe. Ein pädagogisches Dilemma.
In: Neue Praxis, 47(4), S. 354-370.
Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik (2017): Von behindernden Praxen zu einer Reformulierung des Behinderungsbegriffs.
In: Behindertenpädagogik, 56(3), S. 267-282.
Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik (2017): Behinderung, Fluchtmigration, Kommunikation.
In: Teilhabe, 56(4), S. 150-155.
Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik/ Hauck, Teresa/ Börner, Michael (2017): Auf dem Weg zu Inklusion? – ‚Busfahren‘ als Praxis ethnografischer Inklusionsforschung.
In: Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete (VHN), 86, S. 250-252.
Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik (2016): Inklusive Freizeitgestaltung für ältere Menschen mit geistiger Behinderung – ein Strukturproblem.
In: Teilhabe, 55(1), S. 35-41.
Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik/ Hauck, Teresa (2016): Demenz – Anforderungen an eine pädagogische Praxis.
In: Behindertenpädagogik, 55(3), S. 296-313.
Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik / Börner, Michael (2016): Repräsentanz und Subjektivität im Kontext geistiger Behinderung.
In: Zeitschrift für Inklusion, 10(1), online.
online VolltextTrescher, Hendrik (2016): Anforderungen an professionell handelnde PädagogInnen in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe.
In: Gemeinsam leben, 24(1), S. 31-38.
Link | Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik (2016): Kulturelle Bildung für Menschen mit Behinderung.
Das Pilotprojekt 'TOLL'.
In: Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik (SZH), 22(5-6), S. 42-48.
Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik (2016): Freizeit als Fenster zur Inklusion. Konstruktionen von Teilhabe und Ausschluss für erwachsene, institutionalisiert lebende Menschen mit ‚geistiger Behinderung‘.
In: Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete 85(2), S. 98-111.
Link | Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik (2015): Die Würde des Privaten. Zur Diskussion institutionalisierter Lebensbedingungen von Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung.
In: Behindertenpädagogik, 54(2), S. 136-153.
online Volltext | Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik/ Hauck, Teresa (2015): Ambivalenz und Inklusion.
Subjektivierungspraxen in der integrativen Kindertagesstätte.
In: Neue Praxis, 45(5), S. 488-502.
Link | Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik / Hauck, Teresa (2015): Demenz und Diskurs.
Reproduktion einer modernen Ordnungskategorie vs. Inklusive Perspektiven pädagogischen Handelns.
In: Der Pädagogische Blick, 23(4), S. 197-208.
Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik (2015): Zielperspektive Inklusion.
Freizeit von Menschen mit geistiger Behinderung.
In: Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik (SZH), 21(9), S. 39-46.
Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik (2015): TOLL – Potenziale eines Magazins von und mit Menschen mit geistiger Behinderung.
In: Gemeinsam leben, 23(4), S. 245-253.
Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik (2014): Demenz als Hospitalisierungseffekt? Demenz als sonderpädagogische Herausforderung!
In: Behindertenpädagogik, 53(1), S. 30-47.
Link | Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik / Klocke, Janos (2014): Kognitive Beeinträchtigung mit Butler verstehen - Butler im Kontext kognitiver Beeinträchtigung verstehen.
In: Behindertenpädagogik, 53(3), S. 285-308.
Link | Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik / Börner, Michael (2014): Sexualität und Selbstbestimmung bei geistiger Behinderung? – Ein Diskurs-Problem!
In: Zeitschrift für Inklusion, 8(3), online.
Volltext/Open AccessTrescher, Hendrik (2014): Diskursteilhabebarrieren durchbrechen.
Potenziale eines Print- und Online-Magazins von und mit Menschen mit geistigen Behinderungen.
In: Teilhabe, 53(4), S. 169-175.
Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik (2013): Behinderung als demokratische Konstruktion.
Zum objektiven Sinn und ‚cultural impact‘ der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen.
In: Zeitschrift für Inklusion, 7(4).
online Volltext/Open AccessTrescher, Hendrik/ Fischer, Markus (2013): Scham und Akquise.
In: Neue Praxis, 43(2), 2013, S. 199-210.
Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaBeiträge zu Sammelbänden
Trescher, Hendrik/ Nothbaum, Peter (2024): Sexualität bei Menschen mit ‚geistiger Behinderung‘ – Ambivalenzen von Selbstbestimmung zur Diskussion.
In: Kuhn, Karolin/ Renzikowski, Joachim/ Schellhammer, Barbara (Hrsg.): Sexuelle Selbstbestimmung bei Menschen mit kognitiven Einschränkungen?
Baden-Baden: Nomos, S. 275-292.
Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik/ Nothbaum, Peter (2023): Jugendliche mit geistiger Behinderung - Sexualität als Gegenstand der Betrachtung.
In: Kieslinger, Daniel/ Owsianowski, Judith (Hrsg.): Theorie und Praxis der Jugendhilfe 44.
Inklusion in den Erziehungshilfen IV - Sexualität bei Menschen mit Behinderung.
Dähre: Schöneworth Verlag, S. 10-21.
Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik/ Nothbaum, Peter (2023): Partizipation und Partizipationsbarrieren von Menschen mit Behinderung in Deutschland.
In: Sommer, Jörg (Hrsg.): Kursbuch Bürgerbeteiligung #5.
Berlin: Republik Verlag, S. 385-397.
Link | Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik/ Hauck, Teresa/ Börner, Michael (2022): „Kommune Inklusiv“? – Potenziale und Herausforderungen inklusiver Sozialraumentwicklung.
In: Wansing, Gudrun/ Schäfers, Markus/ Köbsell, Swantje (Hrsg.): Teilhabeforschung – Einführung in ein neues Forschungsfeld. Methodologien, Methoden und Projekte der Teilhabeforschung.
Wiesbaden: VS, S. 437-451.
online Link | Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik (2022): Barriere.
In: Kessl, Fabian/ Reutlinger, Christian (Hrsg.): Sozialraum – eine elementare Einführung.
Wiesbaden: Springer VS, S. 451-461.
online Link | Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher Hendrik/ Börner Michael (2021): Perspektiven inklusiver Sozialraumentwicklung - Empirische Befunde zu Inklusionspotentialen des Lebensbereichs Freizeit Erlebnis.
In: Freericks, Renate/ Brinkmann, Dieter (Hrsg.): Gemeinschaft - Transformation. Berufsfeld Freizeit und Tourismus im Umbruch.
Bremen: Institut für Freizeitwissenschaft und Kulturarbeit e.V., S. 151-170.
VolltextTrescher, Hendrik (2020): Auszug und (Nicht-)Ablösung aus dem Elternhaus von Menschen mit geistiger oder komplexer Behinderung.
In: Landesverband für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung NRW e.V. (Hrsg.): Ich selbst? Bestimmt! - Selbstbestimmt Wohnen mit hohem Unterstützungsbedarf.
Düsseldorf: verlag selbstbestimmtes leben, S. 139-152.
Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik (2020): Inklusion ist ein ambivalenter und krisenhafter Prozess. Zum relationalen Verhältnis von Raum, Subjekt und Inklusion.
In: Benze, Andrea / Rummel, Dorothee (Hrsg.): Inklusionsmaschine Stadt.
Berlin: Jovis, S. 95-102.
Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaHauck, Teresa / Trescher, Hendrik (2020): Pädagogisches Handeln in der Behindertenhilfe mit Adorno verstehen.
In: Andresen, Sabine / Nittel, Dieter / Thompson, Christiane (Hrsg.): Erziehung nach Auschwitz bis heute. Aufklärungsanspruch und Gesellschaftsanalyse.
Norderstedt: BoD, S. 275-290.
Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik (2020): Lebensweltliche Aspekte von Menschen mit geistiger Behinderung und Demenz.
In: Birkholz, Carmen / Knedlik, Yvonne (Hrsg.): Teilhabe bis zum Lebensende? Palliative Care gestalten mit Menschen mit geistiger Behinderung.
Marburg: Lebenshilfe-Verlag, S. 187-193.
Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaGrosche, Michael / Gottwald, Claudia / Trescher, Hendrik (2020): Über die Schwierigkeiten, einen systematischen und umfassenden Diskurs zwischen verschiedensten Perspektiven der Sonderpädagogik zu initiieren.
Ein subjektiver Erfahrungsbericht und Reflexionsversuch.
In: Dies. (Hrsg.): Grundsatzdiskurs in der Sonderpädagogik.
München u.a.: Reinhardt, S. 118-125.
Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik (2019): Sonderpädagogik als Erfahrungswissenschaft aus poststrukturalistischer Perspektive.
In: Dederich, Markus / Ellinger, Stephan / Laubenstein, Désirée (Hrsg.): Sonderpädagogik als Erfahrungs- und Praxiswissenschaft. Geistes-, sozial- und kulturwissenschaftliche Perspektiven.
Bad Heilbrunn: Klinkhardt, S. 35-50.
Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik / Hauck, Teresa (2019): Inklusion im relationalen Raum.
Ethnographische Sozialraumbegehungen zwischen Teilhabe und Ausschluss. In: Ricken, Gabi / Degenhardt, Sven (Hrsg.): Vernetzung, Kooperation, Sozialer Raum – Inklusion als Querschnittaufgabe.
Bad Heilbrunn: Klinkhardt, S. 227–231.
Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik (2018): Wie Bürokratie ‚behindert‘ macht.
In: Schilling, Elisabeth (Hrsg.): Verwaltete Biographien.
Wiesbaden: Springer VS, S. 225-247.
Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik (2017): Wider der Versorgungspragmatik. Inklusion als Kritik gouvernementaler Behinderungspraxen.
In: Laubenstein, Désirée / Scheer, David (Hrsg.): Sonderpädagogik zwischen Wirksamkeitsforschung und Gesellschaftskritik.
Bad Heilbrunn: Klinkhardt, S. 277-286.
Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik (2017): Zur bürokratischen Überformung der Subjekte. Wohnen in der stationären Alten- und Behindertenhilfe.
In: Meuth, Miriam (Hrsg.): Pädagogisch institutionelles Wohnen.
Wiesbaden: Springer VS, S. 245-266.
Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik (2016): Grundlagen der Objektiven Hermeneutik.
In: Katzenbach, Dieter (Hrsg.): Qualitative Forschungsmethoden in der Sonderpädagogik. Stuttgart: Kohlhammer, S. 183-193.
Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik (2016): Objektive Hermeneutik in der Anwendung. Ethnographische Beobachtung und Institutionelle Strukturanalyse am Beispiel des Forschungsfelds Demenz.
In: Katzenbach, Dieter (Hrsg.): Qualitative Forschungsmethoden in der Sonderpädagogik.
Stuttgart: Kohlhammer, S. 228-240.
online Link | Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik (2016): Feldzugang bei kognitiver Beeinträchtigung – am Beispiel der direkten Beforschung demenziell erkrankter Personen.
In: Katzenbach, Dieter (Hrsg.): Qualitative Forschungsmethoden in der Sonderpädagogik.
Stuttgart: Kohlhammer, S. 31-41.
Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik / Oevermann, Ulrich (2016): (Sonder-)pädagogische Fallakquise und ihre Problemfelder. Am Beispiel der Thematik Adipositas im Kindes- und Jugendalter.
In: Katzenbach, Dieter (Hrsg.): Qualitative Forschungsmethoden in der Sonderpädagogik.
Stuttgart: Kohlhammer, S. 17-30.
Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaTrescher, Hendrik (2015): Von der Re- zur Dekonstruktion von Demenz.
In: Fürstaller, Maria / Datler, Wilfried / Wininger, Michael (Hrsg.): Zur Geschichte und zum Selbstverständnis Psychoanalytischer Pädagogik. Opladen: Budrich, S. 217-234.
Volltext über Research Gate | Volltext über AcademiaHerausgeberschaften
Grosche, Michael / Gottwald, Claudia / Trescher, Hendrik (2020): Diskurs in der Sonderpädagogik.
Widerstreitende Positionen. München u.a.: Reinhardt.
Grosche, Michael / Gottwald, Claudia / Trescher, Hendrik (2019-2020): Themenstrang Diskurs in der Sonderpädagogik – Sonderpädagogik im Diskurs.
In: Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete (VHN).Expertise
Trescher, Hendrik (2016): Elections. Voting Rights of Persons with Disabilities and their Right to Run in Elections.
In: German Institute for Human Rights (ed.): Implementation of Selected OSCE Commitments on Human Rights and Democracy in Germany. Independent Evaluation Report on the occasion of the German. OSCE Chairmanship 2016, S. 83-93.
Volltext/Open AccessTrescher, Hendrik (2016): Wahlrecht von Menschen mit Behinderung.
In: Deutsches Institut für Menschenrechte (Hrsg.): Die Umsetzung ausgewählter OSZE-Verpflichtungen zu Menschenrechten und Demokratie in Deutschland. Unabhängiger Evaluierungsbericht anlässlich des deutschen OSZE-Vorsitzes 2016, S. 96-108.
Volltext/Open AccessProjektabschlussberichte
Trescher, Hendrik gemeinsam mit Katzenbach, Dieter; Börner, Michael; Nothbaum, Peter; Ebe, Sophie; Fehl, Moritz (2022):
Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitforschung zum Projekt „Kommune Inklusiv“.Trescher, Hendrik (2019):
Abschlussbericht „Barrierefreiheit und kognitive Beeinträchtigung“.
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, im Erscheinen.Trescher, Hendrik (2019):
Abschlussbericht „Barrierefreiheit und kognitive Beeinträchtigung“. Übersetzung in Leichter Sprache.
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, im Erscheinen.Trescher, Hendrik gemeinsam mit Katzenbach, Dieter; Börner, Michael; Hauck, Teresa; Knöß, Davin (2019).
Zwischenbericht der wissenschaftlichen Begleitforschung zum Projekt „Kommune Inklusiv“.Reihenherausgeberschaft
Seit 2017 Mitherausgeberschaft der Reihe „Frankfurter Beiträge zur Erziehungswissenschaft (gegründet von Frank-Olaf Radtke)
Vortragstätigkeiten
27.11.2024 - Wissenschaftliche Begleitung von Kommune Inklusiv
(gemeinsam mit Dieter Katzenbach)
Podiumsdiskussion auf der Jahrestagung der Aktion Mensch, Erfurt26.11.2024 - Soziologische Reflexionen über ‚Behinderung und Inklusion‘
Tagesworkshop für das Integrationsbüro Kreis Offenbach, Frankfurt am Main19.11.2024 - Kommune Inklusiv - Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung des Projekts der Aktion Mensch
Workshop auf der Fachtagung des Evangelischen Kirchentags, online19.11.2024 - Kommune Inklusiv - Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung des Projekts der Aktion Mensch
Vortrag auf der Fachtagung des Evangelischen Kirchentags, online14.11.2024 - Wann bin ich eine Barriere und wie gehe ich damit um?
Workshop der Tagung „Fachtag Unterstützte Kommunikation“, Regionale Fortbildung, Schwäbisch Hall13.11.2024 - Behinderung als Praxis. Barrieren im Hilfesystem?!
Keynote der Tagung „Fachtag Unterstützte Kommunikation“ Regionale Fortbildung, Schwäbisch Hall26.09.2024 - Barrierefreiheit für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen
Stadt Freiburg im Breisgau23.09.2024 - Sexualität als (Forschungs-) Gegenstand in der Sonderpädagogik – Ergebnisse und Erkenntnisse aus der Studie „Sexualität im Kontext geistiger Behinderung“
(gemeinsam mit Peter Nothbaum)
Sektionstagung der DGFE Sektion Sonderpädagogik, TU Dortmund16.07.2024 - Perspectives on inclusion. Methodological approaches
University of Mostar15.07.2024 - Perspectives on Inclusion
University of Sarajevo28.06.2024 - Was braucht Inklusion?
Podiumsdiskussion auf der Jahrestagung Versicherer im Raum der Kirchen, Erfurt27.06.2024 - Partizipation und Netzwerkstrukturen in Inklusionsprojekten. Chancen, Risiken, Perspektiven. Über das Projekt Kommune Inklusiv
Workshop bei der Jahrestagung Versicherer im Raum der Kirchen, Erfurt27.06.2024 - Inklusion in der Kommune
Keynote der Jahrestagung Versicherer im Raum der Kirchen, Erfurt07.06.2024 - Wohnräume inklusiv gestalten
Stadt Marburg07.02.2024 - Einstellungen zu Inklusion
Universität Marburg02.02.2024 - Sozialraum und Inklusion. Empirische Erkenntnisse und pädagogische Reflexionen
Universität zu Köln16.11.2023 - Kommune Inklusiv. Lessons learned
(gemeinsam mit Dieter Katzenbach)
Aktion Mensch, Bonn23.06.2023 - Childhood Living. Children With Severe Disabilities in Day Care Units
Universität Bologna19.06.2023 - Kinder in inklusiven Kindertageseinrichtungen
Philipps-Universität Marburg14.06.2023 - Inklusion in der Stadt
TU München24.05.2023 - Kommune Inklusiv: Ergebnisse und Ausblick
Aktion Mensch, Bonn17.04.2023 - Kommune Inklusiv: Rückschau und Reflexionen II
Aktion Mensch, Bonn24.04.2023 - Inclusion and Tourism in the balkan Aerea
University of Tirana, Tirana13.03.2023 - The Future of local social developmet
London, University of London14.02.2023 - Kommune Inklusiv: Rückschau und Reflexion
(gemeinsam mit Dieter Katzenbach)
Mainz02.02.2023 - Leben und Wohnen als pädagogische Herausforderung in der stationären Kinder- und Jugendhilfe, sowie in der Altenhilfe.
Keynote der Jahrestagung des Instituts für familiale und öffentliche Erziehung, Bildung und Betreuung e.V.
(in Kooperation mit dem Fachbereich Erziehungswissenschaften der Goethe-Universität)
Goethe-Universität, Frankfurt am Main13.10.2022 - Partizipation und Netzwerkstrukturen in Inklusionsprojekten. Chancen, Risiken, Perspektiven (Workshop)
Tagung: s_innovation. Gesellschaft gestalten – wissenschaftlich, vielfältig, barrierearm, partizipativ
Evangelische Hochschule, Bochum30.09.2022 - Sexualität bei Menschen mit ‚geistiger Behinderung‘. Paradoxien von Selbstbestimmung zur Diskussion
Tagung: Be- / Ge- Hinderte Sexualität. Beziehungen unter Menschen mit geistiger Behinderung, unterstützen, ermöglichen, begleiten, schützen.
Halle an der Saale26.09.2022 - Inklusive Netzwerke gestalten (Workshop)
(gemeinsam mit Dieter Katzenbach)
Forchheim, Stadt Erlangen22.07.2022 - Allgemeine Sonder- und Heilpädagogik. Eine theoretische Standortbestimmung
Universität Koblenz-Landau01.06.2022 - Wohnen heißt Zuhause zu sein. Über das Wohnheim als Zuhause, Fragen von Aneignung, Würdeerhalt und dem Privaten
(Ganztagsworkshop)
Lebenshilfe Bayern, Schweinfurt19.05.2022 - Lebensentwürfe von Menschen mit „geistiger Behinderung“
Fachtagung der Johannes Diakonie: Lebensweg - Lebensleistung - Lebensgeschicht
Mosbach13.05.2022 - Was heißt eigentlich ‚Wissenschaftliche Begleitung‘? Am Beispiel des Projekts ‚Kommune Inklusiv‘
Friedrich-Alexander-Universität, Erlangen-Nürnberg14.05.2022 - „Social Construction of What?“ – Ian Hacking and his impact on inclusion
University of Ljubljana28.03.2022 - Hin zur inklusiven Kommune?
Aktion Mensch (gemeinsam mit Dieter Katzenbach)
Bonn18.02.2022 - Sexualität und Selbstbestimmung und (komplexe) Behinderung – Paradoxien zur Diskussion
Fachtagung: Be-/Ge-hinderte Sexualität – zwischen Schutz und Ermöglichung.
Halle an der Saale13.12.2021 - Soziale Probleme in der Totalen Institution. Lebenslagen von Menschen mit Behinderungen während der Corona-Pandemie
Vortragsreihe „Andere als Gefahr – die Gefährdung der Anderen. Die Pandemie als gesellschaftliches Problem“ der Deutschen Gesellschaft für Soziologie
Siegen02.12.2021 - Inklusion als Aneignung im Sozialraum
Université Fribourg / Schweiz15.11.2021 - Ambivalenzen pädagogischen Handelns im Kontext der Gestaltung von Wohnangeboten für Menschen mit "geistiger Behinderung"
Fachtagung der Lebenshilfe Bayern, Landshut11.11.2021 - Politische Partizipation von Menschen mit Behinderung stärken
ConSozial, Nürnberg28.09.2021 - Einblicke in innovative, inklusive Sozialraumkonzepte
Deutscher Caritasverband, Freiburg im Breisgau24.09.2021 - Zur Professionalisierungsbedürftigkeit pädagogischen Handelns am Beispiel integrativer Kindertageseinrichtungen
2. Innsbrucker Fachtagung zur Elementarpädagogik (mit Michael Börner)
Universität Innsbruck24.09.2021 - Behinderung als Praxis. Inklusion als Kritik. Empirische Ergebnisse und theoretischer Überbau
Universität Zürich16.09.2021 - Ambivalenzen von Teilhabe und Inklusion. Ethnographische Sozialraumbegehungen als Werkzeug teilhabe-orientierter Forschung
2. Kongress der Teilhabeforschung.
Münster in Westfalen15.09.2021 - Institutionalisierte Lebensbedingungen von Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung in Zeiten von Corona
2. Kongress der Teilhabeforschung.
Münster in Westfalen14.07.2021 - Wo fängt Inklusion an und wo hört sie ggf. auf?
Workshop zu Möglichkeiten und Grenzen der Inklusionsplanung, virtuell, Aktion Mensch28.05.2021 - Reflections on Easy Language
International Easy Language Day Conference (IELD) 2021
Mainz28.04.2021 - Strategieentwicklung in der kommunalen Inklusionsplanung
Workshop, Aktion Mensch
Bonn16.04.2021 - Selbstermächtigung und Beteiligung von Menschen mit Behinderung im (kommunalen) Inklusionsprozess; Empowerment und Inklusion (k)ein Gegensatz
Tagung: Mit uns zum Wir. Inklusion in Paderborn
Paderborn09.04.2021 - Einführung in die Verfahren der Objektiven Hermeneutik
Philipps-Universität Marburg
Marburg25.03.2021 - Empowerment und Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung
Tagung: Empowerment im medizinischen Diskurs – Chancen und Herausforderungen an der Schnittstelle von Neurologie und palliativer Versorgung
Marburg03.03.2021 - Raum für Inklusion?
Netzwerk Inklusion
Marburg25.11.2020 - Kommune Inklusiv in Schwäbisch Gmünd
Schwäbisch Gmünd, Stadt Schwäbisch Gmünd03.11.2020 - Kommune Inklusiv – Begleitung eines Pilotprojekts
Vorstand Aktion Mensch (gemeinsam mit Dieter Katzenbach)
Bonn28.10.2020 - Politische Partizipation von Menschen mit Behinderung stärken
ConSozial, Nürnberg02.09.2020 - Kommune Inklusiv?! - Aufbau und (Zwischen-)Ergebnisse eines Projekts zur kommunalen Verwirklichung von Inklusion
Ausschusses für Generationen, Soziales, Kultur und Migration der VG Nieder-Olm
Verbandsgemeinde Nieder-Olm26.06.2020 - Ambivalenzen von Barrierefreiheit, Ambivalenzen ‚Leichter Sprache‘ & ‚Geistige Behinderung‘ als Ausschlusskategorie
- Kommune Inklusiv - Workshop zur Aufarbeitung bisheriger wissenschaftlicher Ergebnisse III (gemeinsam mit Michael Börner, Dieter Katzenbach, David Knöß, Teresa Hauck)
virtuell, Aktion Mensch25.06.2020 - Reichweite in den Sozialraum & Inklusionspotenzial Freizeit
- Kommune Inklusiv - Workshop zur Aufarbeitung bisheriger wissenschaftlicher Ergebnisse II (gemeinsam mit Michael Börner, Dieter Katzenbach, David Knöß, Teresa Hauck)
virtuell, Aktion Mensch18.06.2020 - Unscharfe Inklusionsverständnisse
- Kommune Inklusiv - Workshop zur Aufarbeitung bisheriger wissenschaftlicher Ergebnisse I (gemeinsam mit Michael Börner, Dieter Katzenbach, David Knöß, Teresa Hauck)
virtuell, Aktion Mensch25.02.2020 - Einführung in die Taktik des Fußballs inklusiv erklärt II
Maison Schmitt
Frankfurt am Main07.02.2020 - Ambivalences of so-called „Easy Language"
Konferenz Diversity in Cognition (gemeinsam mit Teresa Hauck)
Dortmund23.01.2020 – Reflexionen von Inklusion
Demokratie Leben
Neu-Isenburg13.01.2020 - Sozialraum(entwicklung) und Inklusion
Inklusionsbeirat Rhein-Neckar-Kreis
Heidelberg09.12.2019 - Einführung in die Taktik des Fußballs inklusiv erklärt I
Maison Schmitt
Frankfurt am Main15.11.2019 - Inklusive Räume oder „Territorien der Anderen?“
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (Österreich), Tagung 'DISTAnte RÄUME' (mit Teresa Hauck)26.09.2019 – Diskurs in der Sonderpädagogik – Sonderpädagogik im Diskurs: Vorstellung und Diskussion eines innovativen Buchprojekts
Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaften (DGfE) 2019 (mit Claudia Gottwald und Michael Grosche)
Bergische Universität Wuppertal18.09.2019 - Einstellungen zum Thema Inklusion - Ergebnisse aus der Auswertung eines deutschlandweiten Surveys
Aktion Mensch e.V.
Bonn06.08.2019 – People with intellectual disabilities and the relationship to their birth family
IASSIDD 2019
Glasgow (Vereinigtes Königreich)13.06.2019 – Zur Beforschung von Sozialräumen
Verbandsgemeinde Nieder-Olm05.06.2019 – Sozialraum Surveys – Ergebnisse, Perspektiven, Grenzen
Kommune Inklusiv
Schneverdingen20.05.2019 – Inklusion – Raum – Barrierefreiheit (Podiumsdiskussion)
Philipps-Universität Marburg03.04.2019 – Inklusion und Bewusstsein – Inklusion ist Krisenhaft
Aktion Mensch e.V.
Verbandsgemeinde Nieder-Olm02.04.2019 – Herausforderungen und Perspektiven der Pädagogik bei Beeinträchtigungen der geistigen Entwicklung.
Leibniz Universität Hannover02.04.2019 – Pädagogisches Handeln – Verstehen als Perspektive
Leibniz Universität Hannover18.03.2019 – Pädagogisches Handeln und Inklusion. Ambivalenzen, Herausforderungen, Perspektiven.
Caritas Speyer, Zweibrücken23.01.2019 – Pädagogische Projekte – ein Überblick
(mit Teresa Hauck) Philipps-Universität Marburg18.01.2019 – Inklusionsmaschine Stadt (Podiumsdiskussion)
Werkstattgespräche
Hochschule München05.12.2018 – Inklusion in der Kita. Dekonstruktion als kritische Reflexion
Technische Hochschule Köln/ Universität zu Köln, Forum Inklusive Bildung
Köln09.11.2018 – Behinderteneinrichtungen und das Inklusionsparadigma. Transformationen, Hürden und Potenziale
Luzerner Tagung zur Behindertenrechtskonvention 2018
Hochschule Luzern24.10.2018 – Behinderung als Praxis. Inklusion als Kritik
Universität Koblenz-Landau
Landau23.10.2018 – Kommune Inklusiv. Begleitung eines Pilotprojekts
Aktion Mensch e.V. (gemeinsam mit Dieter Katzenbach)
Bonn16.10.2018 – 'Kognitive Beeinträchtigung' und (Barriere)Freiheit
Bundesfachstelle für Barrierefreiheit
Berlin11.10.2018 – 'Lebensentwürfe von Menschen mit 'geistiger Behinderung' - methodische Reflexionen zu objektiv hermeneutische Analysen
Katholische Hochschule NRW
Münster27.09.2018 – Raum und Inklusion
Universität Hamburg, 53. Arbeitstagung der Sektion Sonderpädagogik in der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (mit Teresa Hauck)
Hamburg14.09.2018 – Ermächtigungspraxen von ‚Menschen mit geistiger Behinderung‘
Diversity Netzwerktreffen
Technische Universität München04.09.2018 – Inklusion – denken und machen
Aktion Mensch e.V. (mit Michael Börner)
Stadt Erlangen15.06.2018 – Inklusion - Maßnahmen – Evaluation
(mit Michael Börner)
Goethe-Universität Frankfurt12.06.2018 – Behinderung als Praxis. Inklusion als Kritik
Universität Kassel01.06.2018 – Inklusion und Profession. Zur Ambivalenz einer normativen Idee
KLGH
Universität Rostock25.05.2018 – Perspektiven des ambulant betreuten Wohnens
Lebenshilfe Frankfurt am Main e.V. (mit Teresa Hauck)
Frankfurt am Main08.05.2018 – Barrierefreiheit und kognitive Beeinträchtigung
BAR-Arbeitsgruppe „Barrierefreie Umweltgestaltung“
Frankfurt am Main25.04.2018 – Inklusion als Herausforderung integrativer Kindertageseinrichtungen
Goethe-Universität Frankfurt15.03.2018 – Barrierefreiheit und politische Partizipation
Rat behinderter Menschen
Berlin28.02.2018 – Was heißt Inklusion?
Fachtagung zum Projekt „Kommune Inklusiv“
Köln26.02.2018 – Inklusion und Evaluation
(mit Michael Börner)
Goethe-Universität Frankfurt22.01.2018 – Behinderung als Praxis - Inklusion als Kritik: Autismus Dekonstruieren?!
Martin Luther-Universität Halle-Wittenberg22.01.2018 – Pädagogik bei geistiger Behinderung - Verstehen
Martin Luther-Universität Halle-Wittenberg12.12.2017 – Inklusion evaluieren?!
Kommune Inklusiv
Schwäbisch Gmünd11.12.2017 – Care Environments for People with Severe Challenging Behaviour
Aurora, Bristol18.11.2017 – Kita und Dekonstruktion. Inklusion als Herausforderung für integrative Kindertageseinrichtungen
(mit Teresa Hauck und Michael Börner), Zukunftsforum Bildungsforschung, Frühe Bildung 2.0? (Forschungs-)Diskurse in der Pädagogik der Kindheit. Früh-, Grundschul- und Sozialpädagogik im Dialog
Pädagogische Hochschule Karlsruhe26.10.2017 – Pflege. Wer, wie, wann und die Frage nach der Würde
Universität Tübingen, INTERNATIONALES ZENTRUM FÜR ETHIK IN DEN WISSENSCHAFTEN
Tübingen26.10.2017 – Demenz. Kritische Perspektiven
Universität Tübingen, Fachgespräch des Projekts Materia
Tübingen19.10.2017 – Disability between Social Construction and Affective Experience
7th international conference “The Social Pathologies of Contemporary Civilization”
Goethe-Universität Frankfurt12.09.2017 – Bürokratie und Behinderung. Zur Praxis des ‚Behindert-werdens‘ im Hilfesystem
Diversity-Netzwerktreffen „Intersektionalitätsperspektiven in der Diversitätsforschung“
Universität Göttingen13.07.2017 – Behinderung als Praxis. Der Versuch der Entwicklung einer Theorie und die Krux mit der Normativität
Arbeitstagung der AG Theorien und Begriffe in der Sonderpädagogik
Universität zu Köln06.07.2017 – Inclusive Leisure Time for People with Cognitive Disabilities vs. A Disabling Care System
ALTER Conference
Lausanne24.06.2017 – The Role of the Birth Family for People with intellectual Disabilities
International Symposium ‚FAMILIES, RIGHTS & DISABILITY‘
Universität Innsbruck16.06.2017 – Geistige Behinderung als Praxis
KLGH
Universität Würzburg22.05.2017 – Behinderung als Praxis. Inklusion als Kritik
Philipps-Universität Marburg04.04.2017 – Workshop für PraktikerInnen: Stationäres Wohnen gestalten
Goethe-Universität Frankfurt06.03.2017 – Rostock auf dem Weg zur Kommune Inklusiv begleiten
Stadt Rostock02.03.2017 – Schneverdingen auf dem Weg zur Kommune Inklusiv begleiten
Schneverdingen13.02.2017 – Verbandsgemeinde Nieder-Olm auf dem Weg zur Kommune Inklusiv begleiten
Verbandsgemeinde Nieder-Olm10.02.2017 – Schwäbisch Gmünd auf dem Weg zur Kommune Inklusiv begleiten
Stadt Schwäbisch Gmünd07.02.2017 – Wohin mit dem Wohnheim? – Institutionsanalyse und Organisationsentwicklung in der Stationären Behindertenhilfe
Lebenshilfe Frankfurt am Main e.V.
Frankfurt am Main03.02.2017 – Inklusion wissenschaftlich begleiten. Kick-Off des Modellprojekts Kommune Inklusiv
Aktion Mensch
Bonn22.01.2017 – Subjekt und Behinderung
Universität Leipzig09.12.2016 – Partizipative Forschung und Forschendes Lernen
Lebenshilfe Frankfurt e.V.
Frankfurt am Main27.09.2016 – Exploring Emotions within Contexts of Education
University of Tel Aviv26.09.2016 – Qualitative Methods in the Field of Social and Educational Science
University of Tel Aviv21.09.2016 – Wider der Versorgungspragmatik. Inklusion als Kritik gouvernementaler Behinderungspraxen
Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaften (DGfE), Sektion Sonderpädagogik
Universität Paderborn16.09.2016 – Vermittlung und Entwicklung qualitativer Methoden im Kontext interprofessioneller Handlungsansätze in Public Health
Alice-Salomon Hochschule Berlin02.09.2016 – Ziele und Aufgaben einer inklusiven Pädagogik
Pädagogische Hochschule Wien/Krems26.08.2016 – Projects using qualitative Methods
Universität Ljubljana07.07.2016 – Vermittlung und Entwicklung eines qualitativen Methodenprogramms für die Pflege- und Gesundheitswissenschaften
Philosophisch-Theologische Vallendar28.05.2016 – Inklusive Freizeit für Menschen mit geistiger Behinderung. Chancen, Barrieren, Perspektiven
KLGH
Universität Koblenz-Landau28.05.2016 – Wohnräume als methodische Herausforderung
Universität Koblenz-Landau16.01.2016 – Aktuelle Herausforderungen der Heilpädagogik
MSB Berlin08.01.2016 – Wohnen und kognitive Beeinträchtigung
Goethe-Universität Frankfurt15.12.2015 – Inklusion. Begriff und Empirie
Goethe-Universität Frankfurt15.09.2015 – Institutionalisiertes Leben! Institutionalisiertes Denken?
Goethe-Universität Frankfurt14.07.2015 – Mediale Repräsentanz von Behinderung
Goethe-Universität Frankfurt10.04.2015 – Heilpädagogik und Inklusion. Ein Spannungsverhältnis?
Hochschule Niederrhein10.04.2015 – Inklusion und Disability Studies als konzeptionelle Grundlagen in der heilpädagogischen Praxis und sozialen Arbeit
Hochschule Niederrhein26.11.2014 – Sozialpädagogische Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigungen im Spannungsfeld heilpädagogischer Beziehungsarbeit und Inklusion
Hochschule Darmstadt13.11.2014 – Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung. Empirische Erkenntnisse zu einem diskursiven Problem
Technische Universität Dortmund26.07.2014 – Zielperspektive Inklusion?!
Tagung der Lebenshilfe
Frankfurt am Main14.07.2014 – Freizeit inklusive!
Stadt Frankfurt am Main14.10.2013 – Inklusion als pädagogische Herausforderung
Goethe-Universität Frankfurt12.10.2013 – „Demenz“ rekonstruieren. Objektiv-hermeneutische Analysen von Lebenslagen demenziell erkrankter Menschen im Heim
Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaften (DGfE)
Universität Wien19.06.2013 – Teilhabe von Menschen mit geistigen Behinderungen in Frankfurt
Goethe-Universität Frankfurt03.12.2012 – Der Wert ethnographischer Beobachtungen
Goethe-Universität Frankfurt26.06.2012 – Tagungsworkshop Objektive Hermeneutik
Goethe-Universität FrankfurtAktuell betreute Dissertationsprojekte
Gerhard Suder
Sichtachsen auf schulische Inklusion - Die Entwicklung der Kommunikation in Pool-Modellen für Schulbegleitung
Seit einigen Jahren werden vielerorts Pool-Modelle für Schulbegleitung als innovativer Ansatz zur Überwindung systemimmanenter Widersprüche und Herausforderungen der Einzelfallhilfe erprobt. Dabei begegnen sich in den Leistungsträgern, Leistungserbringern und Schulen drei Organisationen, die in dieser Konstellation sonst nicht zusammenarbeiten. Das lässt zunächst Herausforderungen bezüglich der Kommunikation zwischen den Organisationen und darüber hinaus Auswirkungen auf schulische Inklusion erwarten. Trotz zunehmender Forschungsaktivitäten zum Thema Schulbegleitung fehlen bisher systematische, theoriegeleitete Untersuchungen mit Fokus auf die Ebene der Organisationen.
Das Forschungsvorhaben stellt ausgehend von der Theorie sozialer Systeme (Niklas Luhmann) und einem diskurstheoretischen Inklusionsverständnis (Hendrik Trescher) die Frage: „Wie entwickelt sich die Kommunikation zwischen den beteiligten Organisationen in Pool-Modellen für Schulbegleitung während der Einführungsphase und welche Auswirkungen ergeben sich daraus auf schulische Inklusion?“
Ausgehend von Niklas Luhmanns Systemtheorie, die soziale Systeme als operativ geschlossen und selbstreferenziell versteht, ermöglicht das Projekt eine Analyse der je eigenen Funktionen, Strukturen und Ziele der beteiligten Organisationen. Alle am Pool-Modell beteiligten Organisationen werden dabei als eigenständige Teilsysteme betrachtet. Es wird deren Kommunikation mit den jeweils anderen Systemen untersucht.
Hendrik Trescher versteht Inklusion als Dekonstruktion von Diskursteilhabebarrieren. Damit stellt sich die Frage, wie sich das Pool-Modell für Schulbegleitung auf Teilhabemöglichkeiten, resp. Teilhabebarrieren für Schüler*innen am schulischen Bildungsdiskurs auswirkt. Diese Frage ermöglicht es, die praktische Relevanz der organisationsübergreifenden Kommunikation für die tatsächliche Teilhabe in der Schule zu beleuchten.
Zur Beantwortung der Forschungsfrage(n) werden Expert*inneninterviews als Topic-Interviews mit Entscheidungsträger*innen aus Pool-Modellprojekten in Norddeutschland durchgeführt. Ergänzend werden öffentlich zugängliche Dokumente in die Auswertung einbezogen. Die Daten werden mit der qualitativen Inhaltsanalyse und Elementen aus der Grounded Theorie ausgewertet.
Kontakt: gerhard.suder@uni-marburg.deSarah Rouschal
Beziehungsarbeit in der Traumapädagogik: Möglichkeiten und Grenzen der Beziehungsarbeit nach dem Konzept der Traumapädagogik innerhalb der stationären Kinder- und Jugendhilfe
Die Heimerziehung als konkrete Unterbringungsform der stationären Kinder- und Jugendhilfe stellt eine stetig zunehmende und häufige Maßnahme der Hilfen zur Erziehung im deutschen Sozialstaat dar. Obwohl die Unterbringung junger Menschen in einer Wohngruppe als effektiv bezeichnet wird, scheitern viele Einrichtungen an der eigentlichen Chance dieser, den jungen Menschen sichere und korrigierende Bindungserfahrungen zu ermöglichen. Die Chance ergibt sich aus der theoretischen Betrachtung der Heimerziehung als bindungsorientiertes Konstrukt, welches sich anhand der Bindungstheorie nach J. Bowlby betrachten lässt. Dieser Fakt bedeutet gleichwohl nicht, dass die Heimerziehung als bindungsorientierte Praxis zu verstehen ist, denn aus (inter-)nationalen Forschungen geht hervor, dass diese Aufgabe noch aussteht. Demnach lassen sich Bedingungen der Heimerziehung aufzeigen, die die Beziehungsarbeit begrenzen oder sogar verhindern. Solche Grenzen können mitunter auf struktureller Ebene bestehen und exemplarisch ein fehlendes handlungsleitendes Konzept der Einrichtung, eine fehlende pädagogische Grundhaltung der Fachkräfte und die psychischen Traumata/ Erkrankungen der jungen Menschen betreffen.
Die noch recht neue Fachrichtung der Traumapädagogik stützt sich u.a. auf J. Bowlbys Bindungstheorie und schafft dabei einen Bezug zu der Bedeutung von psychischen Traumata.
Dadurch wird rein konzeptionell ein bindungsorientierter Rahmen geschaffen, der zunehmende Nutzung im stationären Kontext erfährt. Ob das Konzept wirklich zu der Etablierung einer bindungsorientierten Praxis in der Heimerziehung führen kann, gilt es jedoch noch zu erforschen.
Demnach ist das Dissertationsziel die Erforschung von Möglichkeiten und Grenzen der Beziehungsarbeit nach dem Konzept der Traumapädagogik innerhalb der stationären Kinder-
und Jugendhilfe.
Mittels teilstrukturierter Leitfadeninterviews werden pädagogische Fachkräfte aus dem Handlungsfeld der Heimerziehung zu dem Konzept der Traumapädagogik befragt. Eine qualitativ- inhaltsanalytische Auswertungsmethode generiert die für die Forschungsfragen relevanten kategorialen Möglichkeiten und Grenzen.
Kontakt: sarahrouschal@googlemail.comPeter Nothbaum
Unterstützte Sexualität im Kontext von Menschen mit ‚geistiger Behinderung‘.
Eine kritische Reflexion von Dienstleistungen aktiver Sexualassistenz
Das Promotionsvorhaben adressiert ein Feld, welches lange tabuisiert wurde. Erst im Zuge des sog. Paradigmenwechsels, der die Normalisierung der Lebensverhältnisse von Menschen mit ‚geistiger Behinderung‘ zum Ziel hat, wurde ihm ein größerer Stellenwert zugeschrieben. Nichtsdestotrotz konnte die dort geforderte selbstbestimmte Sexualität bisweilen kaum eingelöst werden.
In diversen Studien (Trescher 2015, 2017a, 2017b, 2018) konnte herausgearbeitet werden, dass Menschen mit ‚geistiger Behinderung‘ Privatsphärenverletzungen ausgesetzt und über wenig persönliche Handlungsökonomie verfügen. Es drängt sich die Frage auf, wie selbstbestimmte Sexualität unter diesen Rahmenbedingungen überhaupt eingeübt werden kann. Dienstleistungen aktiver Sexualassistenz sollen in diesem Kontext, so die weit verbreitete Anschauung der Bezugswissenschaften, Abhilfe schaffen. Diesbezüglich existiert zwar eine Fülle von Veröffentlichung, sie sind jedoch zumeist handlungspraktisch ausgerichtet und kaum theoriegeleitet bzw. forschungsbasiert. Fragen nach Konstruktionen von ‚geistiger Behinderung‘, ‚Selbstbestimmung‘ und ‚Sexualität‘ werden weitestgehend außer Acht gelassen werden. Diese gilt es jedoch in den Blick zu nehmen, da das Feld der selbstbestimmten Sexualität ohnehin schon durch tiefgreifende Spannungen gekennzeichnet ist; bei der Übertragung auf das Feld der 'geistigen Behinderung' potenziert sich das Spannungsfeld.
Mittels eines qualitativen Forschungszugangs sollen Praktiken aktiver Sexualassistenz rekonstruiert, multiperspektivisch betrachtet und reflektiert werden. Dafür werden Topic-Interviews mit Personen gegenständlich sein, die in Dienstleistungen aktiver sexueller Assistenz für Menschen mit sog. geistiger Behinderung direkt oder indirekt involviert sind. Ausgewertet werden die Interviews mithilfe der Verfahren der Objektiven Hermeneutik.
Kontakt: peter.nothbaum@uni-marburg.deSonja Weidmann
Un/ Doing Behavioural Problems
Das Promotionsvorhaben mit dem Titel „Un/ Doing Behavioural Problems – Stigmatisierung, Normalisierung oder Negierung von auffälligemVerhalten bei Kindern“ adressiert ein pädagogisches Spannungsfeld, das als auffällig, abweichendes, oder problematisch markiertes Verhalten bei Kindern oft mit exkludierenden Praktiken begegnet. Mit Hilfe der Herstellung einer medizinischen oder sonderpädagogischen Diagnose einer „Verhaltensauffälligkeit“ beginnt für Kinder im schulfähigen Alter nicht selten eine Karriere an der Förderschule und damit verbundene Stigmatisierungserfahrungen. Weitere mögliche Praktiken können die Negierung sein – also ein gezieltes Un-Doing oder nicht-Kategorisierung von kindlichem Verhalten, selbst wenn das Verhalten als nicht den Normerwartungen entsprechend wahrgenommen wird; oder eine Normalisierung im Sinne von Um-Deutung oder Disziplinierung eines Verhaltens.
Pädagogische Interaktionen spielen sich in einem institutionellen und damit von Machtverhältnissen geprägten Raum ab, innerhalb welchem Normalitätserwartungen und Differenzierungen zwischen normal und „auffällig“ der Pädagog*innen zur Herstellung von sozialen Konstrukten führen können. In diesem Forschungsvorhaben soll daher die Herstellung („Doing“) der Kategorie „Verhaltensauffälligkeit“ sowie Praktiken des „Undoing“ im Hinblick auf komplexe Machtverhältnisse untersucht werden. Unter den metatheoretischen Voraussetzungen der dokumentarischen Methode sollen teilnehmende Beobachtungen und Interviews durchgeführt werden und mittels dieser anschließend ausgewertet werden.
Erstbetreuung: Prof. Dr. Hendrik Trescher, Zweitbetreuung: Prof. Dr. Florian Kiuppis (Rheinland-Pfälzische Technische Universität, Kaiserslautern-Landau)
Kontakt: sonja.weidmann@uni-marburg.deAnna Lamby
Das Verständnis von Kinder- und Jugendpsychotherapeut:innen bzgl. sogenannter geistiger Behinderung
Mit Blick auf die Kinder- und Jugendpsychotherapie im Kontext sogenannter geistiger Behinderung werden Prozesse der Ausgrenzung und Teilhabebeeinträchtigung deutlich. Im hier vorliegenden Promotionsvorhaben wird die Kinder- und Jugendpsychotherapie – nach Foucault – als Diskurs und Behinderung – nach Trescher – als Praxis verstanden, die sich immer dann vollzieht, wenn Subjekte in bestimmten Situationen an Diskursteilhabebarrieren stoßen. Insbesondere mit Blick auf Kinder- und Jugendpsychotherapie im Kontext von sogenannter geistiger Behinderung werden Diskursteilhabebarrieren – unter anderem aufgrund des eingeschränkten bzw. verwehrten Zugangs – deutlich. Es stellt sich die Frage, inwiefern die Kinder- und Jugendpsychotherapie als Diskurs explizit Behinderung hervorbringt bzw. diese abbauen kann? Daran anknüpfend sollen im hier vorliegenden Promotionsvorhaben mögliche (latente) Diskursteilhabebarrieren der Kinder- und Jugendpsychotherapie identifiziert werden. Zur Ermittlung dieser wird das Verständnis von Kinder- und Jugendpsychotherapeut:innen bzgl. sogenannter geistiger Behinderung untersucht und erhoben, wie in diesem Kontext sogenannte geistiger Behinderung konstruiert wird. Dabei wird zudem den Fragen nachgegangen, inwieweit sich der Diskurs der Kinder- und Jugendpsychotherapie (im Kontext des Verständnisses von sogenannter geistiger Behinderung) als ‚behindert‘ bzw. ‚behindernd‘ darstellt. Im Zuge dessen wird darüber hinaus nach möglichen Handlungsempfehlungen gefragt, welche sich aus dem Verständnis von Kinder- und Jugendpsychotherapeuten bzgl. sogenannter geistiger Behinderung ergeben.
Da der aktuelle Forschungsstand sowohl bzgl. des Verständnisses von sogenannter geistiger Behinderung als auch bzgl. der Kinder- und Jugendpsychotherapie im Kontext dessen bisher noch weitgehend unbeforscht ist, knüpft das hier vorliegende Promotionsvorhaben gleich an mehrere Desiderate an.
Gegenständlich werden zur Untersuchung der vorangegangenen Forschungsfragen Leitfadeninterviews mit Kinder- und Jugendpsychotherapeut:innen geführt und mittels qualitativer sowie rekonstruktiv-hermeneutischer Verfahren ausgewertet. Hierdurch sollen die (latenten) Diskursteilhabebarrieren für Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung in der Kinder- und Jugendpsychotherapie offengelegt werden.
Kontakt: akl@lamby.deVerena Wahl, MA:
Handeln mit digitalen Artefakten in Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe
In einer «Kultur der Digitalität» (Stalder, 2016) findet das Handeln mit digitalen Artefakten über alle Lebensbereiche statt. Für einige Personengruppen kann jedoch ein «digital divide» (Ragnedda, 2017) konstatiert werden, welcher sich durch schlechteren Zugang (first level divide), Unterscheidung in den Nutzungsweisen (second level divide) digitaler Artefakte sowie daraus resultierende «life chances» (third level divide) bemerkbar macht. Dieser «digital divide» kann insbesondere für Personen, welche in Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe wohnen, festgestellt werden (Scanlan, 2022).
Mit Bezug auf die Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT) wird das Handeln mit digitalen Artefakten in dieser Arbeit als verteiltes Handeln in sozio-technischen Konstellationen konzipiert. Es wird davon ausgegangen, dass sich die vier Arten technischer Vermittlung, wie sie von Latour (2001) beschrieben werden, auch im Handeln mit digitalen Artefakten in Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe wiederfinden. Im Fokus der Analyse der Arbeit stehen die Handlungsorientierungen und -praktiken der Mitarbeitenden dieser Einrichtungen unter der Fragestellung, wie sich die vier Arten technischer Vermittlung in diesen Handlungspraktiken wiederfinden. Von pädagogischem Interesse ist hier, inwiefern diese Praktiken Partizipation ermöglichen oder dieser gegebenenfalls entgegenstehen und hinsichtlich der Zielperspektive Inklusion aktualisiert werden müssen. Hierfür wurden Gruppendiskussionen mit Mitarbeitenden der Behindertenhilfe geführt und diese mit Hilfe der Dokumentarischen Methode (Bohnsack, 2009) ausgewertet.
Erstbetreuung: Prof. Dr. Hendrik Trescher,
Zweitbetreuung: Prof. Dr. Florian Kiuppis (Rheinland-Pfälzische Technische Universität, Kaiserslautern-Landau).
Kontakt: verena.wahl@uni-marburg.deSilvia Rügner, MA:
Auszug aus dem Elternhaus unter behindernden Umständen. Konstruktionen des Auszuges aus dem Elternhaus von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen.
Mit dem Dissertationsvorhaben wird der Frage nachgegangen, wie sich der erste Übergang aus dem Elternhaus in ein neues Wohnsetting von Personen mit körperlichen Beeinträchtigungen gestaltet. Für diesen Zweck sollen Personen mit körperlichen Beeinträchtigungen, deren Auszug aus dem Elternhaus möglichst in der nahen Vergangenheit liegt, als Interviewpersonen gewonnen werden. Somit sollen die erhobenen Informationen unmittelbar von den betroffenen Personen stammen und dadurch einen Einblick in ihre persönlichen Erlebnisse und den damit einhergehenden emotionalen Erfahrungen ermöglichen. Im Fokus der Betrachtung soll der Übergang aus dem Elternhaus in das neue Wohnsetting stehen. Fragen nach der Auszugsmotivation, den Vorbereitungen auf den Umzug, den strukturellen und emotionalen Herausforderungen, welche mit dem Umzug einhergehen sowie der Phase unmittelbar nach dem Umzug dienen als Grundlage des Erkenntnisinteresses. Analysiert werden sollen die erhobenen Interviews mit dem qualitativ mehrschichtigen Auswertungsverfahren der objektiven Hermeneutik. Hierdurch sollen tiefgreifende subjektive sowie übergreifende Interessen im Hinblick auf den Auszug aus dem Elternhaus von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen offengelegt werden.
Kontakt: silvia.ruegner@uni-marburg.deJudith Dubiski, MA:
Inklusion als Kritik. Dekonstruktion von Ordnungen im (sozial-)pädagogischen Handlungsfeld
Sozialpädagogische Handlungsfelder – wie die Kinder- und Jugendarbeit – sehen sich mit der Aufforderung konfrontiert, Inklusion „umzusetzen. Dabei bleibt der Inklusions-Begriff jedoch zumeist unreflektiert und wird an zu erfüllende Kriterien geknüpft, die eine Bearbeitung von Ausgrenzungsmechanismen eher verhindern als ermöglichen. Zugleich gehen bestehende Ansätze von Inklusion zumeist davon aus, dass es sich um eine Aufgabe handelt, die von den professionellen pädagogisch oder helfend tätigen Personen abzuarbeiten sei.Begreift man „Inklusion“ jedoch als die Gegenbewegung zu Behinderung, als Kritik an Ordnungen des Ausschlusses, oder – mit Foucault – als „die Kunst, nicht dermaßen regiert zu werden“, geraten Praktiken der Kritik in den Blick. Das Augenmerk dieser Arbeit soll daher den Momenten der Kritik in Settings der Jugendarbeit gelten, in denen durch konkrete Praktiken bzw. konkrete Praxis von Jugendlichen, der Fachkräfte und anderer Personen (bspw. Eltern) bestehende Ordnungen durchbrochen, umgangen, in Un-Ordnung versetzt werden.Die zentralen Fragestellungen des Dissertationsprojekts lauten:
1. Welche Praktiken der Kritik an prozessierten Ordnungen des Diskursausschlusses lassen sich im Setting von als „inklusiv“ konzipierten Angeboten der Jugendarbeit beobachten?
2. (Wie) Wird an diese Momente angeschlossen, auf die Kritik geantwortet?
3. Durch welche Bedingungen werden solche Momente wahrscheinlicher und was lässt sich daraus für pädagogische Praxis folgern?
Methodologisch lässt sich die Arbeit als diskursanalytisch fundierte Praxeologie einordnen. Es ist vorgesehen, vier unterschiedliche, als „inklusiv“ konzipierte Settings der Jugendarbeit ethnographisch zu beforschen und teilnehmend zu beobachten.
Das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit ist damit einerseits ein theorieentwickelndes, andererseits ein pädagogisch-kritisches.
Erstbetreuung: Prof. Dr. Hendrik Trescher, Zweitbetreuung: Prof. Dr. Andrea Platte (TH Köln)
Kontakt: j.dubiski@gmx.deVictoria Mehringer, MA:
Familien mit Migrationserfahrung und einem Kind mit Behinderung als heterogene Zielgruppe im Einwanderungsland DeutschlandFamilien mit Migrationserfahrung und einem Kind mit Behinderung stehen vor vielfältigen Herausforderungen. Neben sprachlichen Barrieren, gibt es eventuell kulturelle Differenzen in Bezug auf Behinderung zwischen dem Herkunfts-und dem Aufnahmeland und erlebte Mehrfachdiskriminierung. Migration kann als Übergang verstanden werden, der in komplexe, mehrdimensionale Interdependenzen eingebettet ist. In diesem Dissertationsprojekt soll der der Frage nachgegangen werden, wie sich Migration von Familien mit einem Kind mit Behinderung gestaltet. In der Dissertation soll untersucht werden, wie sich die Kategorien „Migration“ und „Behinderung“ in ihrer Bewältigung gegenseitig beeinflussen, ob eine Wechselwirkung besteht und welche Kontextfaktoren diesen Übergangsprozess beeinflussen. So wird die Frage gestellt, wie die Familien die Behinderung eines Kindes bewältigen, auch mit Blick auf eventuell bestehende kulturspezifische Unterschiede. Gleichzeitig soll auch untersucht werden, wie sich die Assimilation von Familien mit einem Kind mit Behinderung im sozialen Kontakt, auf struktureller Ebene und in der kulturellen Identifikation gestaltet. Auch Teilhabeaspekte und die Orientierung im Hilfesystem sollen in den Blick genommen werden.
Dazu wird durch ein Mixed Methods Design eine quantitative Erhebung vorangestellt, die einen Überblick über die sehr heterogene Zielgruppe geben soll. Anschließend soll ein vertiefendes Verständnis von Gegenstandsbereichen durch problemzentrierte Interviews ermöglicht werden, die mit der dokumentarischen Methode ausgewertet werden.
Erstbetreuung: Prof. Dr. Hendrik Trescher, Zweitbetreuung: Prof. Dr. Florian Kiuppis (Rheinland-Pfälzische Technische Universität, Kaiserslautern-Landau)
Kontakt: Victoria.mehringer@outlook.deSamach Saadi
Teachers' Perception of the Influence of Modern Information and Communication Technology (ICT) and Internet in the Digital Learning Environment on Motivation to Learn of Students with Learning DisabilitiesIn the past years, the use of ICT in the education system and building a digital learning environment received much attention. It is not evident to all what a digital learning environment is, what characteristics of a competent digital learning environment are, how to best use technological tools, what innovative pedagogy to aspire to, and how to implement it. The powerful digital technology opens up numerous possibilities in the sphere of information. The social transition from an industrial society to information and internet society compels the teaching staff to use the computer to search and process information and communicate with the world. We will explore the use of technology and computers in light of their benefit to the realization of teaching-learning goals, and the latter will determine the possibility of integration from the view of pedagogical reasoning. Thus, we have to consider the pedagogical concept and learning itself. Teaching-learning goals stem from that concept and define the needs that will shape the technological infrastructure's rational design. The computer has numerous advantages: it is available at any time and any place, allows the student's active involvement, is nonjudgmental and offers immediate feedback. Moreover, it helps students overcome their specific difficulties in reading, writing, learning skills, and/or problems with social skills.
Students with learning disabilities cope with difficulties in several fields: acquisition and use of listening, speaking, reading, writing, thinking, and/or mathematical abilities. The academic difficulties they experience at school can make these students' lives into an ongoing continuum of frustration and failures in everyday coping with their learning tasks. Technological resources - above all, the computer - can play a significant role in helping them cope with their difficulties and pave the way to success in studies and later on in their careers.
The study will seek to present the new perception of knowledge and the principles of the integration of innovative technology in leading the teaching-learning processes at school to achieve the development in students with learning disabilities that manifest in enhanced academic achievements that come with a change in their motivation to learn.
The study will address the innovative computer, communication, and internet technology, focusing on the technological aspect integrated into school pedagogy and learning in a digital learning environment.
Erstbetreuung: Prof. Dr. Hendrik Trescher, Zweitbetreuung: Prof. Dr. Florian Kiuppis (Rheinland-Pfälzische Technische Universität, Kaiserslautern-Landau)Abgeschlossene Dissertationsprojekte
Dr. phil. Michael Börner:
Leben mit geistiger Behinderung. Biographische Zugänge zu Lebensverläufen und Lebensperspektiven von älteren Menschen, die als geistig behindert gelten
Ausgehend von einer kulturwissenschaftlichen bzw. diskurstheoretischen Perspektive, die (geistige) Behinderung nicht als individuelle Pathologie und naturgegebenes Faktum, sondern als historisch gewachsene Differenzkategorie und Produkt machtvoller Diskurse begreift, strebt das Promotionsvorhaben danach, geistige Behinderung als lebensgeschichtlichen Prozess des ‚Behindert-Werdens‘ offenzulegen. Mittels eines biographischen Zugangs sollen hierfür Lebensverläufe im Kontext geistiger Behinderung rekonstruiert und darin eingebettete Subjektivierungspraxen identifiziert und in ihrer Wirksamkeit auf das einzelne Subjekt beleuchtet werden. Gegenständlich sollen narrative Interviews mit berenteten Menschen mit geistiger Behinderung aus verschiedenen Wohnkontexten – welche jeweils unterschiedliche Grade der autonomen Lebensführung eröffnen – geführt und mithilfe rekonstruktiv-hermeneutischer Verfahren ausgewertet werden. Im Zentrum steht dabei die Frage nach der Subjektivität, welche durch das mehr oder weniger eng geflochtene Netz aus institutionalisierten Handlungspraktiken (mit)hervorgebracht wurde bzw. wird und nun – im Rahmen des Interviews – Einblicke in das eigene Leben und die weiteren Zukunftsentwürfe gibt.
Kontakt: michael.boerner@uni-marburg.de
Volltext/Open AccessDr. phil. Dipl.-Pol. Janos Klocke:
Grenzen des Subjekts. Postsouveräne Handlungsfähigkeit nach Foucault und Adorno
Der sozialwissenschaftliche Diskurs um politische Handlungsfähigkeit im Anschluss an Foucault hat die Analyse und Kritik von Praktiken der Subjektivierung zum Gegenstand. Der Lesart Foucaults folgend ist dabei die Handlungsfähigkeit des Subjekts der Moderne ursächlich auf gleichermaßen machtvolle wie ermächtigende Diskurse zurückzuführen, der Gedanke einer ursprünglichen bzw. autonomen Subjektivität zurückzuweisen. Für Adorno hingegen ist die ökonomische Verkehrsform der bürgerlichen Gesellschaft manifester Ausdruck einer (historisch bedingten und aufzulösenden) Trennung von Subjekt und Objekt bzw. Gesellschaft, das Subjekt in diesem Sinne entfremdet bzw. beschädigt. Erscheinen beide Subjekttheorien daher zunächst nur schwer vereinbar, offenbart die weitergehende Analyse überschneidende bzw. sich wechselseitig ergänzende Programmatiken, die innerhalb dieses Dissertationsvorhabens in einer vergleichenden Lesart, von ihren Grenzen ausgehend, hervorgehoben werden sollen. Vereinzelt ist das Verhältnis der Subjekttheorien Adornos und Foucaults bereits thematisiert worden, es fehlt jedoch bislang eine umfassende und systematische vergleichende Rekonstruktion in der Absicht, neben den Widersprüchen beider Konzeptionen vor allem auch nach Anschlussmöglichkeiten zu suchen und diese vor dem Hintergrund aktueller praxistheoretischer Paradigmen zu diskutieren. Ein solches Vorhaben verspricht insbesondere auch mit Blick auf sich zuspitzende politische Diskurse um die Anpassung und Optimierung des „unternehmerischen Selbst“ an die Anforderungen des neoliberalen (Arbeits-)Marktes unter Krisenbedingungen erweiterte subjekttheoretische wie handlungspraktische Perspektiven, zumal die Analyse und Kritik der (spät-)kapitalistischen Gesellschaft im Anschluss an Adorno bis in die Gegenwart ein zentraler Bezugspunkt ökonomie- und herrschaftskritischer Forschungsarbeiten ist. Gerade aus diesem Umfeld wurde poststrukturalistischen TheoretikerInnen häufig ein Mangel an analytischer Trennschärfe in Bezug auf das Verhältnis von Subjektivität und der (Eigen-)Dynamik kapitalistischer Ökonomien vorgehalten, weshalb sich dieses Vorhaben auch explizit in vermittelnder Absicht mit beiden Theoriekonzeptionen von Subjektivität und Gesellschaft auseinandersetzen wird. Darüber hinaus wird das Vorhaben die Konstitution des „behinderten Subjekts“ und seine Verstrickung in gegenwärtige biopolitische Diskurse exemplarisch als immanente Grenze der normativ-ethischen Reichweite beider Subjektkonzeptionen herausstellen. Dabei soll im Anschluss an die transdisziplinäre Programmatik der Disability Studies die Problematik (de-)konstruktivistischer wie mündigkeitszentrierter Subjekttheorien mit Bezug auf die empirisch-praktischen Grenzen ihrer Geltung und der damit verbundenen Gefahr eines Ausschlusses der betroffenen Subjekte von Subjektivität überhaupt diskutiert werden.
Erstbetreuung: Prof. Dr. Martin Saar, Universität Leipzig, Zweitbetreuung: Prof. Dr. Hendrik Trescher
Kontakt: J.Klocke@em.uni-frankfurt.de
LinkDr. phil. Teresa Hauck, MA:
Inklusionsverständnisse
Thema und Fragestellung des Dissertationsprojekts reagieren zum einen auf die Unschärfe des sozialwissenschaftlichen Inklusionsdiskurses, der in einem ‚Inklusionspluralismus‘ kulminiert, und nehmen zum anderen Rückbezug darauf, dass moderne Wohneinrichtung der sogenannten Behindertenhilfe in vielerlei Hinsicht durch totale Strukturrahmen gekennzeichnet sind.
An dieser Divergenz zwischen Unschärfe des Inklusionsbegriffs und der tatsächlichen innerinstitutionellen Lebenspraxis in Wohnheimen für Menschen mit geistiger Behinderung setzt das Dissertationsprojekt an. Das Auseinanderklaffen von Theorie und Praxis und das damit verbundene Desiderat zum Ausgangspunkt nehmend sollen die Inklusionsverständnisse von Mitarbeiter*innen im stationär und ambulant betreuten Wohnen für erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung untersucht werden.
Gegenständlich werden Interviews mit Mitarbeiter*innen unterschiedlicher Betreuungskontexte geführt und anhand der Verfahren der Objektiven Hermeneutik analysiert. Von zentralem Interesse ist dabei, ob und inwiefern Mitarbeiter*innen in ebendiesen Einrichtungen einen Inklusionsdiskurs führen und ob und inwiefern dieser Auswirkungen auf ihr Selbstverständnis und ihre Handlungspraxis hat.
Hinweise für Studierende
Sprechzeiten
Alle Sprechstunden finden nachmittags online statt.
Bitte melden Sie sich per E-Mail direkt bei Herrn Prof. Dr. Trescher.
Ihnen wird dann ein Termin zugeteilt.Hinweise zu Prüfungsformen
• Die Hinweise zu Prüfungsformen können Sie sich hier als PDF-Datei herunter laden.
• Unter diesem Link finden Sie im ILIAS eine Präsentation mit wichtigen Hinweisen für die Haus- und Abschlussarbeiten als Video.
• Unter diesem Link finden Sie im ILIAS eine Präsentation mit dem Kurzvideo - erste Hausarbeiten schreiben.
Hinweis: Aus technischen Gründen liegen die Videos in einem (für alle Studierenden erreichbaren) ILIAS-Ordner. Falls Sie nicht dort ohnehin schon beigetreten sind, können Sie das mit diesem Link sofort erledigen. Mit Ihrer Anmeldung sind Sie dann auch unverzüglich Mitglied dieses Bereiches.Hinweise zu studentischen Kontaktanfragen
Mich erreichen jedes Semester hunderte studentische Mails und Anfragen, die ich nicht immer alle detailliert beantworten kann. Dies ist die Realität der modernen Universität.
Mit diesem Dokument erhalten Sie Hinweise, die Sie bitte einhalten, damit eine konstruktive Kommunikation stattfinden kann.
Hinweise zu studentischen Kontaktanfragen hier als PDF-Datei.
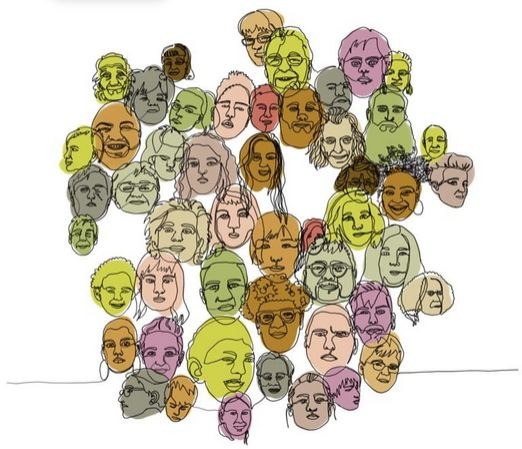
Inklusion ist demokratische Aufgabe
Stellungnahme zur Position des Spitzenkandidaten der AfD in Thüringen
Im MDR-Sommerinterview 2023 stellte Björn Höcke die Behauptung auf, dass Inklusion ein „Ideologieprojekt“ sei, von dem das Bildungssystem „befreit“ werden müsse. Dazu haben 126 in Wissenschaft und Praxis für Inklusion Engagierte in den Printmedien Thüringer Allgemeine, Thüringische Landeszeitung und Ostthüringer Zeitung und im Internet eine Stellungnahme veröffentlicht, die wir (ggf. konkretisieren) unterstützen und zur Weitergabe empfehlen.
Den vollständigen Text der Stellungnahme lesen Sie hier.
1 Die vollständige E-Mail-Adresse wird nur im Intranet gezeigt. Um sie zu vervollständigen, hängen Sie bitte ".uni-marburg.de" or "uni-marburg.de" an, z.B. musterfr@staff.uni-marburg.de bzw. erika.musterfrau@uni-marburg.de.